
Unterwasser-Archäologie:
Marine Archäologischer Workshop in Bodrum (Türkei)
vom 26. September bis 3. Oktober 1998

Dieser Workshop fand im Rahmen der unterwasserarchäologischen Kurse des SUSV statt und wurde von der Kontaktstelle Unterwasserarchäologie des SUSV organisiert und durchgeführt.
Ziel und Zweck waren, sich an einer marinen Fundstelle richtig zu verhalten und anhand reiner Beobachtungen - also ohne jegliche Grabungsarbeit - den einen oder anderen Schluss ziehen zu lernen.
Als Vorbereitung dazu dienten Referate über die Geschichte dieser Gegend, Seefahrtswege der alten Völker am Mittelmeer, Vortrag und Führung im unterwasserarchäologischen Museum von Bodrum durch Prof. Dr. George Bass, Leiter des INA (Institute of Nautical Archaeology) und Tauchexkursionen in der Region mit Askin Diving.
Der Höhepunkt waren die Tauchgänge an einer kleinen Insel, bei der eine Wrackstelle vermutet wurde.
Der vorliegende Bericht umfasst das Resultat mehrerer Tauchgänge der Gruppe und ist ein erster Versuch, aufgrund der Sichtung des Materials Schlüsse zu ziehen.
Fachleute müssen überprüfen, ob diese richtig sind. Die Gruppe hat sie nach bestem Wissen und Gewissen und langen Diskussionen zusammengetragen.
Organisiert durch:
ã SUSV-Kontaktstelle Unterwasserarchäologie
In den Zielbäumen 6
CH-4143 Dornach
Wrackstelle: Geographische Lage
Umsegeln auf der nördlichen Lee-Seite
Umsegeln im weiten Bogen auf der Luvseite
Umsegeln mit knappem Kurs auf der Luvseite:
Durch spontane Hinweise aus Sporttauch-Kreisen wurden wir in Bodrum auf eine vermutliche Wrackstelle aufmerksam gemacht. Die Lage wurde korrekt angegeben, Grösse und genaues Alter des Schiffes waren jedoch unbekannt. Aufgrund der zahlreichen Keramikreste wurde es mit "spätrömisch" datiert. Weitere Angaben über das Wrack fehlten vollständig.
- Prospektion, durch Tauchgänge in Zweierteams an der Fundstelle
- Handskizzieren der sichtbaren Artefakte (Amphoren, Krüge)
- Fotos
- Amphorenbestimmung durch Literatur
- Studium der alten Schifffahrtsrouten und Windrichtungen durch Literatur
- durch Abschwimmen Länge u. Breite des Wracks
Drei Tauchgänge an der Fundstelle in der Türkei im Gebiet vor Bodrum (Halikarnossos).
Tiefe der Fundstelle zwischen 4,5 m und 25 m
Ausdehnung N - S ca. 28 m; E - W ca. 14 m
Tauchgruppe von 9 Personen mit insgesamt 24 Stunden Tauchzeit.
Tauchgänge in Zweiergruppen, um das Ausmass, evtl. Ladung, Streufunde und Aufschlagspunkt festzustellen. Von der Vielzahl der Fundstücke überwältigt, zerstreuten sich die Gruppen und es wurde unkontrolliert prospektiert.
Tauchgang in zwei Zweiergruppen, je obere und untere Hälfte. Spezielle Suche nach aussergewöhnlichen Artefakten, Skizzieren und Fotografieren. Feststellen evtl. Amphorenstempel oder Graffiti. Genauere Ausmasse der Wrackstelle und des Schiffswracks ermitteln.
Tauchgang mit gezielter Untersuchung einzelner Fundgegenstände, deren Herkunft oder Funktion noch unklar war. Weiter wurden noch mehr Amphoren skizziert und photographiert und auf eventuelle Stempel untersucht.
Bei den Amphorenfunden konnten vier Arten bestimmt werden. Es handelt sich ausschliesslich um Weinamphoren aus den Regionen Palästina, Gaza, Aegäis, Schwarzmeer, aus dem 4.-6. Jahrhundert nach Christus. Anhand der Windrichtungen und Schiffahrtsrouten, aus dem östlichen Mittelmeerraum kommend, mit Ausmassen von 20 m Länge und 5,2 m Breite, könnte der Typ (Yassiada) ein Holzlastschiff mit ca. 50 t Nutzlast (entspricht ca. 9000 Amphoren) und einem Rahsegel (schwer manövrierfähig) sein, das auf dieses Riff aufgelaufen und steuerbordseitig gekentert ist.
Da aus dieser Epoche schon viele Funde dokumentiert worden sind, nichts aussergewöhnliches gefunden wurde, und die sichtbaren Artefakte erheblich zerstört sind, ist eine Grabung zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu empfehlen.
Die losen Artefakte hingegen sollten unter Beizug von Fachleuten eingemessen, dokumentiert und geborgen werden. Diese Prospektion würde ca. 1 Woche erfordern.
Wrackstelle: Geographische Lage
Türkei: Südwest-Küste zur Ägäis, in der Nähe von Bodrum [Halicarnassus], in der Nähe der berühmten Wrackstelle des byzantinischen
Yassiada Wracks (7. Jahrhundert n. Chr, Ausgrabungen 1961-1964 durch George Bass und Frederick H. van Doorninck Jr.) liegt dem Festland vorgelagert ein Felsriff.
Die Strasse zwischen Kos und dem türkischen Festland wird von der Antike bis in die heutige Zeit intensiv von der Handelsschifffahrt benutzt, da sie die direkte Verbindung zwischen Rhodos und Istanbul darstellt. Ausserdem sind die Schiffe auf dieser Route durch die vor der Küste liegenden Inseln vor dem offenen Meer geschützt. Wichtige antike Orte wie Rhodos, Halikarnossos [Halicarnassus], Samos, Pergamon und Istambul [Byzanz, Ost-Rom] liegen an der Strecke.
Das Ost-West-orientierte Felsriff ragt heute ca. 12-15m über den Meeresspiegel und ist ca. 150m lang. Vor 2000 Jahre war der Meeresspiegel rund 3m tiefer als heute. Dies erklärt weshalb im obersten Bereich keine antiken Funde gemacht werden. Als generelle Beobachtung - auch auf anderen Plätzen in der Gegend - wurden keine Scherbenfunde oberhalb 4.8m beobachtet! Die Differenz zwischen 3m und 4.8m erklärt sich aus Ebbe-Wasserstand und dann wirksamer Brandungszone, aus der alle beweglichen Objekte herausgespült werden. Im Jahr 1304/1305 ereignete sich ausserdem ein starkes Erdbeben; dies hat zur Folge, dass nicht mehr alle Schichten am urspüngliche Ort liegen.
Im weiteren sollte man die allgemeine Wettersituation in die Betrachtungen miteinbeziehen. Es gibt zwei vorherrschende Windrichtungen:
· Nord-West-Wind im Sommer
· Süd-Ost-Wind im Winter (Scirocco)
Aufgrund der Lage des Wrackplatzes und des Aufschlagpunktes kann man den Zeitpunkt des Unterganges auf ein Winterhalbjahr mit Süd-Ost-Wind datieren. Dies wird auch durch die Art der Ladung bestätigt, wie wir später noch sehen werden. Die weiteren Erklärungen beziehen sich nur noch auf diesen Fall.
Die Gezeitenströmung ist an diesem Riff zeitweise gut spürbar.
Mit einem Rah-Segler an Felsriff vorbeisegeln...
Rahsegelschiffe sind gut geeignet, um vor dem Wind zu segeln. Aufkreuzen ist mit den in der Antike üblichen Rahsegeln nur schwer möglich. Halb am Wind entsteht eine grosse Krängung; ein Kentern kann nur durch rasches Reffen der Segel verhindert werden. Bei plötzlichen Windböen ist dann die Gefahr des Kenterns am grössten! Die antiken Segelschiffe hatten kein Schwert, das ein seitliches Abdriften verhindert hätte und auch der Kiel war nicht speziell ausgeprägt.
Die Wahl der richtigen Route war für diese Art Schiffe entscheidend!
Die Passage auf der Südseite verspricht mehr Sicherheit, da mit grösserem Abstand zur Küste gefahren werden kann. Bei geschicktem Manöverieren mit einem Segelboot lässt sich eine unnötige Kurskorrektur verhindern, da, sobald ein weiter westlich liegendes Riff umfahren wäre, weniger Kurskorrekturen nötig wären!
Es gibt grundsätzlich 3 verschiedenen mögliche Varianten
![]() Umsegeln auf der
nördlichen Lee-Seite:
Umsegeln auf der
nördlichen Lee-Seite:
Durch die Nähe zum Festland müsste das Schiff mit grösser Wahrscheinlichkeit noch einmal Höhe zum Wind gewinnen, um ein weiteres Riff zu umfahren. Ausserdem ist auf Leeseite einer Insel ist im Zweifelsfalle mit einer Sandbank zu rechnen, da Strömungen dort ihr Material ablegen. Genügend Gründe, eine andere Route zu wählen!
![]() Umsegeln im weiten Bogen
auf der Luvseite:
Umsegeln im weiten Bogen
auf der Luvseite:
Von Rhodos kommend ist ein weiter Bogen auf der Luvseite mühsam zu fahren, da man wieder mehr Höhe zum Wind gewinnen oder sonst zu nahe am Lee von Kos segeln müsste.
Dies bedeutet: Risiko für Manöver bei starkem Wind, Verlängerung der Fahrzeit durch Aufkreuzen.
![]() Umsegeln
mit knappem Kurs auf der Luvseite:
Umsegeln
mit knappem Kurs auf der Luvseite:
Scheint auf den ersten Blick eine gutes Manöver zu sein.
Die Gefahr, die versteckt in dieser Situation liegt, ist die, dass durch das genügend hoch über das Wasser ragende Riff (ca. 15m) auch der Wind beeinflusst wird. Der anströmende Wind wird wie bei einem Flugzeugflügel aufgeteilt - es entsteht eine laminare Strömung. Dies bewirkt einerseits eine unerwartet einfallende Böe kurz vor der Insel, da die Windgeschwindigkeit dort zunimmt, andererseits bewirkt der Anstieg der Windgeschwindigkeit ein Gebiet mit reduziertem Luftdruck. Ein Schiff, das in diesen Sog gerät, wird wie von einem Magneten vom Riff angezogen. Dies könnte erklären, weshalb das Schiff, von Osten kommend, am Ende der 2. Bucht gegen das Riff geprallt und anschliessend gekentert ist.

Drei Fundschicht-Züge (1-3) weisen darauf hin, dass das Wrack anschliessend auseinandergebrochen und weiter gesunken ist. Im mittleren Bereich lassen sich zwei offene Einstürze erkennen. Es wird vermutet, dass hier ein grösseres Stück Bordwand für längere Zeit zu liegen kam. Darunter muss sich ein grösserer Hohlraum befunden haben. Durch Gewichtszunahme wegen organischer Ablagerungen und gleichzeitiger Reduktion des Holzes ist die Bordwand später eingestürzt. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als die weiter oben liegenden Scherbenschichten bereits zu einer kompakten Schicht verbacken waren. Durch diesen Einsturz sind zwei nebeneinanderliegende Krater von ca. 3-4m Durchmesser erkennbar. Am oberen Kraterrand (8) lässt sich die Fundschicht sehr deutlich erkennen, am unteren Kraterrand nur erahnen, da hier natürlich auch der Schutt der eingestürzten Bordwand liegt.
Eine ähnliche Situation befindet sich auf ca. 23m in der Mitte des Wrackbereiches (5). Es wird vermutet, dass sich dort eine Bordwand gleichmässig abgestützt auf den Boden gelegt hat. Das Holz ist mittlerweile verschwunden, es sind aber deutliche Rippen mit kleinen darunterliegenden Hohlräumen auszumachen. Interessant in diesem Gebiet ist vor allem eine Konstruktion aus verschiedenen geschichteten Flächen und einem ca.15 cm grossen, runden Loch auf der Oberseite. Auf der Südseite ist ein gleichmässiger viereckiger Hohlraum. Es scheint sich hier nicht um eine natürliche Konstruktion zu handeln. Um welchen Bestandteil des Schiffes oder dessen Ladung es sich hier handelt, konnte nicht festgestellt werden.
Am östlichen Ende des Wrackplatzes beim Übergang des Riffes zur Sandbank (4) , wurden zwei sehr schwere felsähnliche Klumpen entdeckt. Diese weisen beide einen Hohlraum auf und sind deutlich schwerer als einer der umliegenden Steine ähnlicher Grösse. Entgegen ersten Vermutungen, es könnte sich von der Form her um den Fuss einer Bronzestatue handeln, vermuten wir eher, dass es sich um einen vollständig oxidierten Abdruck einer Lenzpumpe oder eines Heckankers handelt. Dies würde auch durch die Lage im Heckbereich eher Sinn ergeben.
![]() Das untere Ende
der Fundzone genauer betrachtet
Das untere Ende
der Fundzone genauer betrachtet
wird der Bodenzuwachs sicher kleiner sein. Es ist deshalb zumindest eine Überlegung wert, ob sich hier tief unter dem Sand noch weitere Ladungsbestandteile befinden.
Selbstverständlich dürfte eine Grabung in diesem Bereich nur im Rahmen von wissenschaftlicher Arbeit im Auftrag der türkischen Behörden geschehen. Bei sämtlichen hier gemachten Beobachtungen wurde ausdrücklich darauf Wert gelegt, nichts am Wrackplatz zu verändern und höchstens lose Teile abzuzeichnen, um diese Zeichnungen an der Oberfläche zur weiteren Auswertung zu verwenden. Sämtliche gefundene Objekte wurden am Originalplatz belassen.

Die Bezeichnung "Amphore" kommt aus dem Altgriechischen und ist eine Kombination von zwei Wörtern: "Amphi" (zweiseitig, zwei Seiten) und "Phoros" (tragbar, portabel). Das bedeutet, das Gefäss kann an zwei Seiten haltend, getragen werden.
Das ursprüngliche Wort "Amphora" kommt aus der mykenischen Linear B Schrift und wurde dort als "Amphoreous" oder auch als "Amphiphoreus" erwähnt. Meistens wurde eine grobe Zeichnung benutzt, um dieses Wort darzustellen.
Die Römer nannten diese zweihenkligen Gefässe "Amphoras". In der frühchristlichen Zeit wurden sie "Megarikon" oder auch "Magarikon" genannt, und während der byzantinischen Zeit "Koupon".

Die Handels-Amphoren waren einfach geformte Gefässe mit schmalem Rand und mit einem Zapfen verschlossen. Sie waren tragbar, mit zwei horizontalen oder vertikalen Henkeln versehen. Manchmal noch zusätzlich mit einem dritten, spitzen Henkel am Gefässboden, der ein einfacheres Entleeren des Inhaltes ermöglichte. Die Amphoren wurden hauptsächlich für den Transport und für die Lagerung von Handelsgütern, wie z.B. Wein, Oel und haltbaren Lebensmitteln gebraucht. Sie waren unentbehrliche Elemente für den Transport in der alten Zeit.
Die ersten Exemplare solcher Amphoren wurden in Troja (3000 v. Chr.) gefunden. Weitere Funde im östlichen Mittelmeerraum stammten aus der frühen Bronzezeit (2000 v. Chr.). Eine weitere grosse Anzahl von Amphoren aus derselben Periode, wurden in bewohnten Gegenden und Gräbern in Syrien und Palästina gefunden.
Bei der Herstellung von Amphoren wurde der Ton auf der Töpferscheibe geformt und schliesslich bei einer geeigneten Temperatur von 800 - 1000 Grad gebrannt. Die Brennöfen waren entweder rechteckig, rund oder birnenförmig und hatten eine Höhe von 3 - 5 Metern. Viele Brennöfen hatten ein Fassungsvermögen von 80 - 100 Amphoren pro Brand.
Bei der Vermessung von Amphoren aus dem 11. Jahrhundert hat man festgestellt, dass derselbe Amphorentyp eine unterschiedliche Dicke der Gefässwände aufwies. Aufgrund des byzantinischen Masssystems lies sich nachweisen, dass Rot- und Weissweine nicht mit dem selben Gewicht gemessen wurden. Rotwein wies das grössere Gewicht auf und wurde aus diesem Grunde in Gefässen mit einer dickeren Gefässwand transportiert.
Wegen ihres teilweise spitzen Bodens konnten die Amphoren gut schichtweise gelagert werden. Aus diesem Grunde wurden sie für den Transport auf dem Seeweg vorgezogen.
Die Amphoren wurden hauptsächlich als Lager- und Transportgefässe gebraucht, aber auch als Dekoration in Form von z.B. verzierten Vasen mit einem Boden oder Sockel. Die Verzierung bestand aus Figuren, Pflanzen und teilweise Darstellungen aus dem Alltagsleben.
Für die Lagerung wurden die Amphoren meist in aufrechte Position gestellt. Die Frage wie dies funktionierte, gab eine ägyptische Wandzeichnung. Auf diesem Fresko kann man sehen, dass die Amphoren in eine Art Halterung aus Schilf gestellt wurden und somit ihre aufrechte Position halten konnten. Halterungen aus Metall konnten ebenfalls ersehen werden. Die Griechen benutzen - anstelle von Metall oder Schilf - Ringe aus Ton.
Um eine Amphore zu transportieren wurde sie je nach Grösse und Gewicht auf der Schulter oder unter dem Arm getragen. Eine weitere Variante war ein Netz, durch welches eine Stange gesteckt und in das die Amphore gelegt wurde, sodass sie von einer oder mehreren Personen getragen werden konnte.
Für den Transport auf Schiffen wurden die Gefässe in der untersten Lage nebeneinander gestellt. Bei weiteren Lagen wurden die nächsten Amphoren einfach in die Zwischenräume der vorhergehenden Gefässe gestellt. Mit Seilen wurden sie gesichert, damit die Ladung nicht ins Rutschen geraten konnte. Amphoren in welchen Oel und/oder Wein transportiert wurden, wurden z.T. senkrecht und z.T. waagrecht gestellt. Die Zwischenräume wurden mit Schilf und Reisig aufgefüllt, damit auch hier die Ladung nicht ins Rutschen geraten konnte.
![]() Zur
Isolierung und Versiegelung von Amphoren
Zur
Isolierung und Versiegelung von Amphoren
Aus geschriebenen Texten aus der hellenistischen und aus der römischen Periode ist zu erfahren, dass die Innenseiten der Amphoren isoliert wurden. Man hat festgestellt, dass Gefässe, in welchen Wein transportiert wurde, mit einer Harzschicht versehen waren. Für den Transport von Oelen wurden die Amphoren mit einer Schicht aus Gummi und/oder Wachs abgedichtet. Zum Schutz des Inhaltes wurden sie noch mit einem Zapfen versiegelt. Diese waren aus Kork, Holz oder anderen organischen Materialien
.
In frühere Zeit wurden Inschriften oder Zeichen auf den Amphoren angebracht. Diese Stempel beinhalteten den Namen des Händlers, den Eigentümer, den Preis der Ware oder die Menge des Inhaltes. Diese Stempel wurden mehrheitlich an den Amphorenhälsen, aber auch auf dem Gefässkörper angebracht.
Beim Fundplatz konnten bedauerlicherweise keine vollständig erhaltenen Amphoren aufgefunden werden. Es ist anzunehmen, dass Gefässe, die beim Untergang des Schiffes nicht zerbrochen wurden, zu späteren Zeiten entfernt wurden. In einer Tiefe von ca. 25 m konnten ein paar Amphorenhälse mit Henkel und einem Teil des Gefässkörpers aufgenommen werden. Diese Gefässe standen in aufrechter Position in Gruppen von 3 - 4 Stück zusammen. Die meisten Bruchstücke befanden sich aber lediglich in einer Tiefe zwischen 4 - 14 m. Die Scherbenstücke sind in einer kompakten Schicht von ca. 30 - 50 cm zusammenkorrodiert. Es ist praktisch unmöglich, einzelne Teile aus dieser Schicht zu entfernen.
Abbildung 4 Fundschicht mit Scherben

Mehr Glück hat man bei Funden zwischen grossen Steinblöcken. Diese z. T. grossen Scherbenstücke liegen dort häufig in den Felsspalten oder auf den Felskanten und sind dadurch gut zugänglich. Die Scherbenteile, die zur Bestimmung der Amphorenarten benutzt wurden, stammten hauptsächlich aus solchen Fundstücken.
Anhand der gezeichneten Amphoren-Funde, der Form, der Verzierung und der Farbe des Tons (hauptsächlich dunkelrot bis braun), lassen sich Amphorentypen bestimmen, die alle aus der Zeit zwischen dem 3. und dem 6. Jh. n. Chr. stammen, d.h. bei dem gefunden "Wrack" muss es sich um ein Schiff aus dieser Zeitperiode handeln.
An den Innenseiten der Fundstücke konnten keinerlei Anzeichen einer Beschichtung, sei es nun Wachs oder Harz, festgestellt werden. Auch Spuren von Zapfen , Stempeln oder sonstige Graffiti fehlen bedauerlicherweise oder konnten wegen des Bewuchses und den Ablagerungen nicht erkannt werden. Trotzdem kann man anhand der Amphorentypen sagen, dass es sich bei der Fracht dieses Schiffes um einen Wein- oder Oeltransport (eher aber um einen Weintransport) gehandelt haben muss. Die grössten bzw. bekanntesten Herstellungs- und Vertriebsorte von Wein liegen, wie aus der Karte auf Seite 58 im Amphorenbuch ersichtlich ist, an der Route, die dieses Schiff vermutlich befahren hat und erhärten die Vermutung noch zusätzlich.
Bei einer der bestimmten Amphorenarten ist das Herkunftsland des Gefässes bekannt. Es handelt sich dabei um eine Amphorenart, die in Palästina hergestellt wurde. Diese Tatsache unterstützt die Vermutung, dass mit den Amphoren eine Art "Recycling" betrieben wurde, d.h. Amphoren wurden für mehr als einen Transport verwendet.
| Herkunft: | Palästina- und Gaza-Region |  |
|||
| Vorkommen: | Süd-östliche Mittelmeer-Region, teilweise Fund auch in West-Europa | ||||
| Ladung: | Möglicherweise Wein, Oliven- oder Sesamoel | ||||
| Datum: | 5 bis 6.Jh.n.Chr. | ||||
 |
Herkunft: Unbekannt | ||||
| Vorkommen: Mittelmeer und Schwarzes Meer | |||||
| Ladung: Vermutlich Wein | |||||
| Datum: 3. - 4. Jh.n.Chr. | |||||
| Alle drei folgenden Zeichungen: | |||
| Herkunft: Unbekannt | |||
| Datum: 4. - 6.Jh.n.Chr. |  |
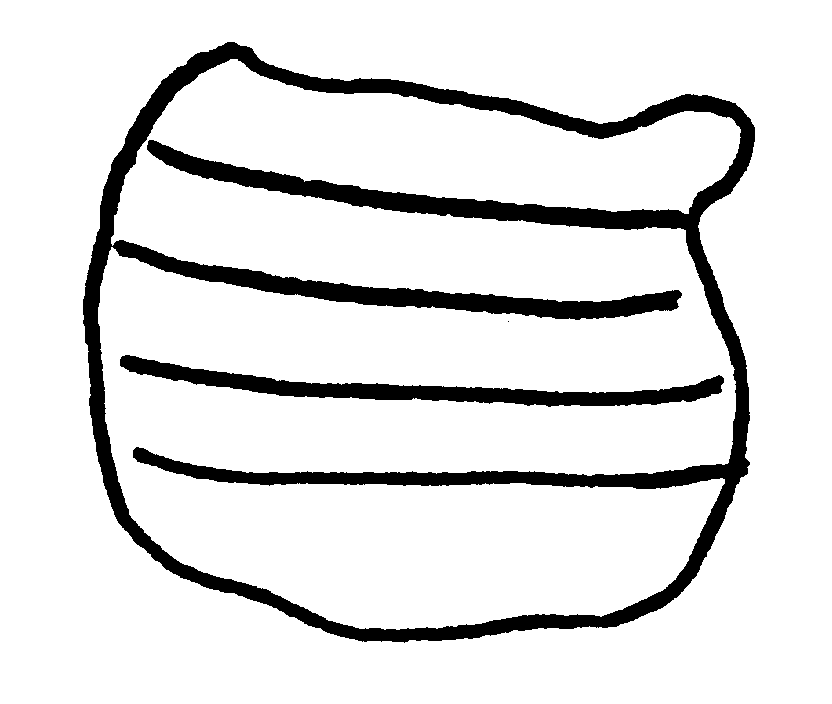 |
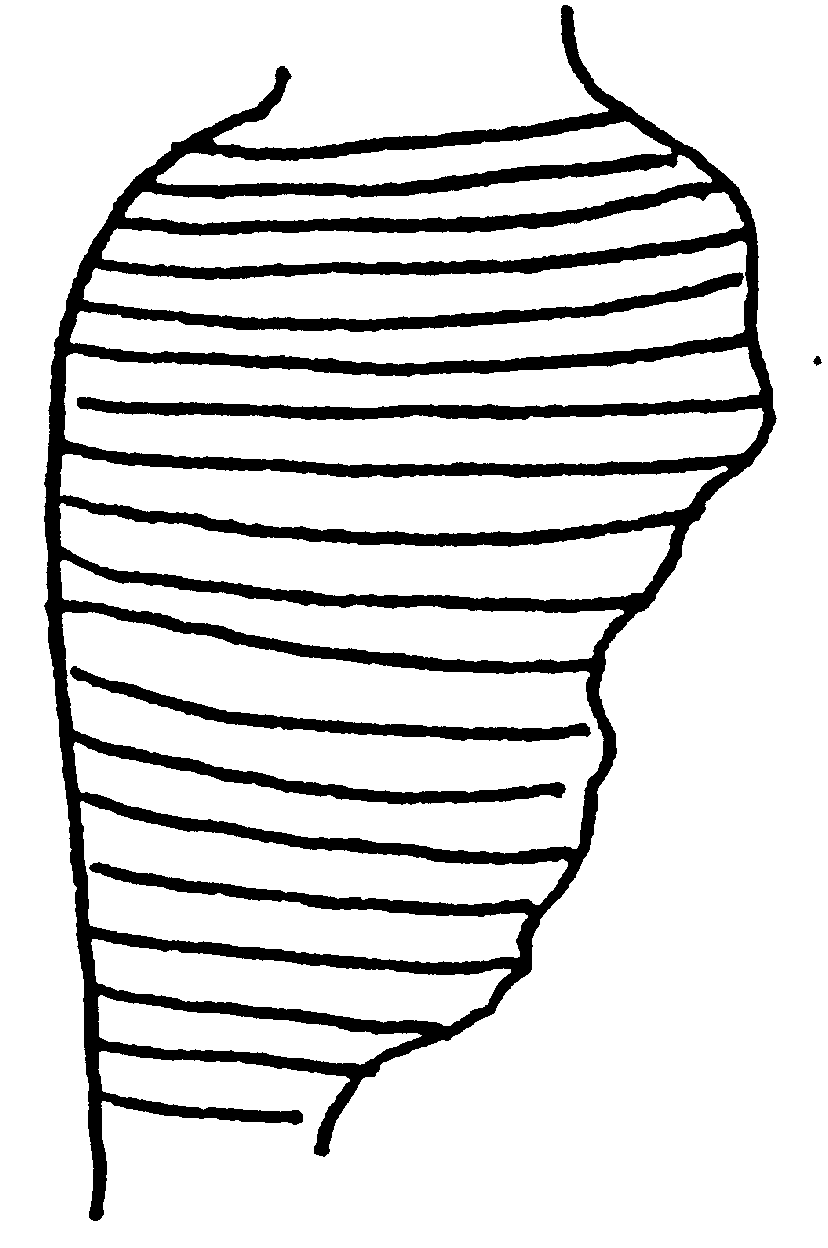 |
| Vorkommen: Mittelmeer, Ägäis, Schwarzes Meer |
|||
| Ladung: Vermutlich Wein | |||
| Abbildung: Seite 109 |
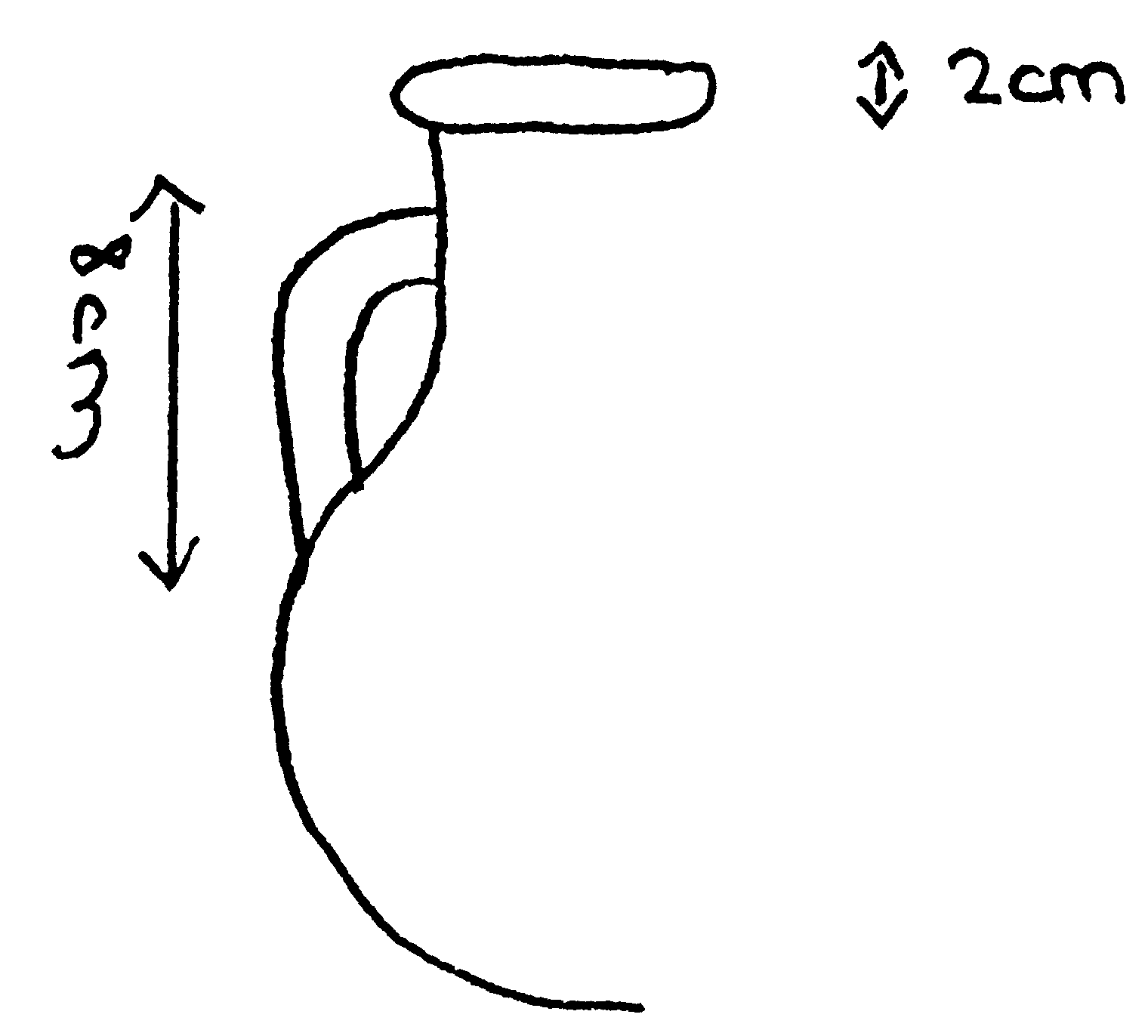 |
Herkunft: nicht definitiv bestimmbar |
| Ladung: nicht definitiv bestimmbar | |
| Vorkommen: nicht definitiv bestimmbar | |
| Datum: nicht definitiv bestimmbar | |
| Abbildung: evt. Seite 16, oben rechts |
Vermutlich Wrack-fremde
Funde:
Zwischen den vorgängig erwähnten Amphorentypen wurden auch zwei
Bruchstücke gefunden, die sich in keiner Weise zu den restlichen
Scherben einreihen lassen. Da es sich nur um Einzelstücke
handelt, könnte es sein, dass es sich dabei um persönliche
Gegenstände der Besatzung handelt. Einer dieser Einzelfunde
konnte als eine afrikanische Amphorenart identifiziert werden.
Das Aussehen des zweiten Einzelfundes erinnert stark an einen
Krug, wie er auch in der heutigen Zeit noch bekannt ist.
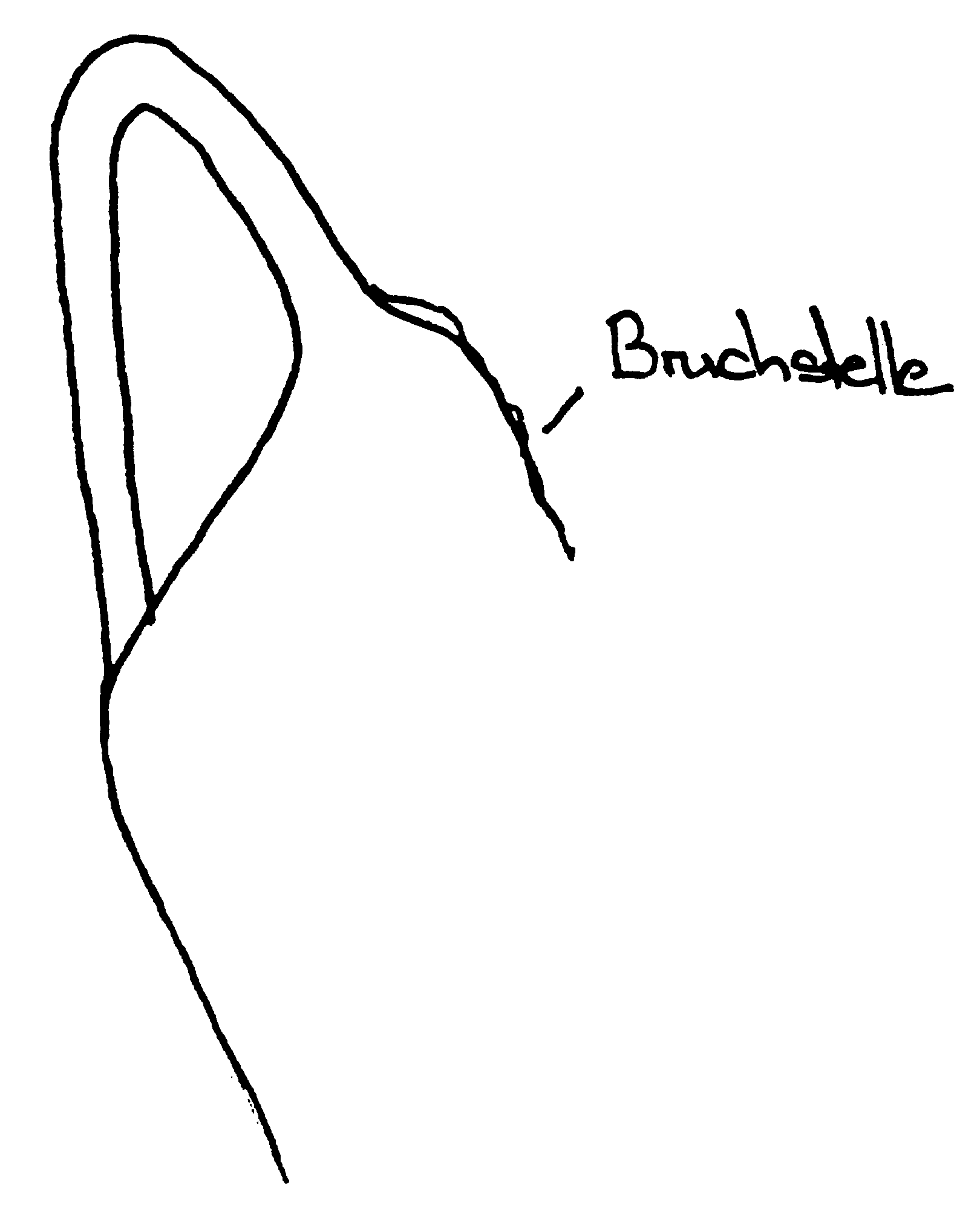 |
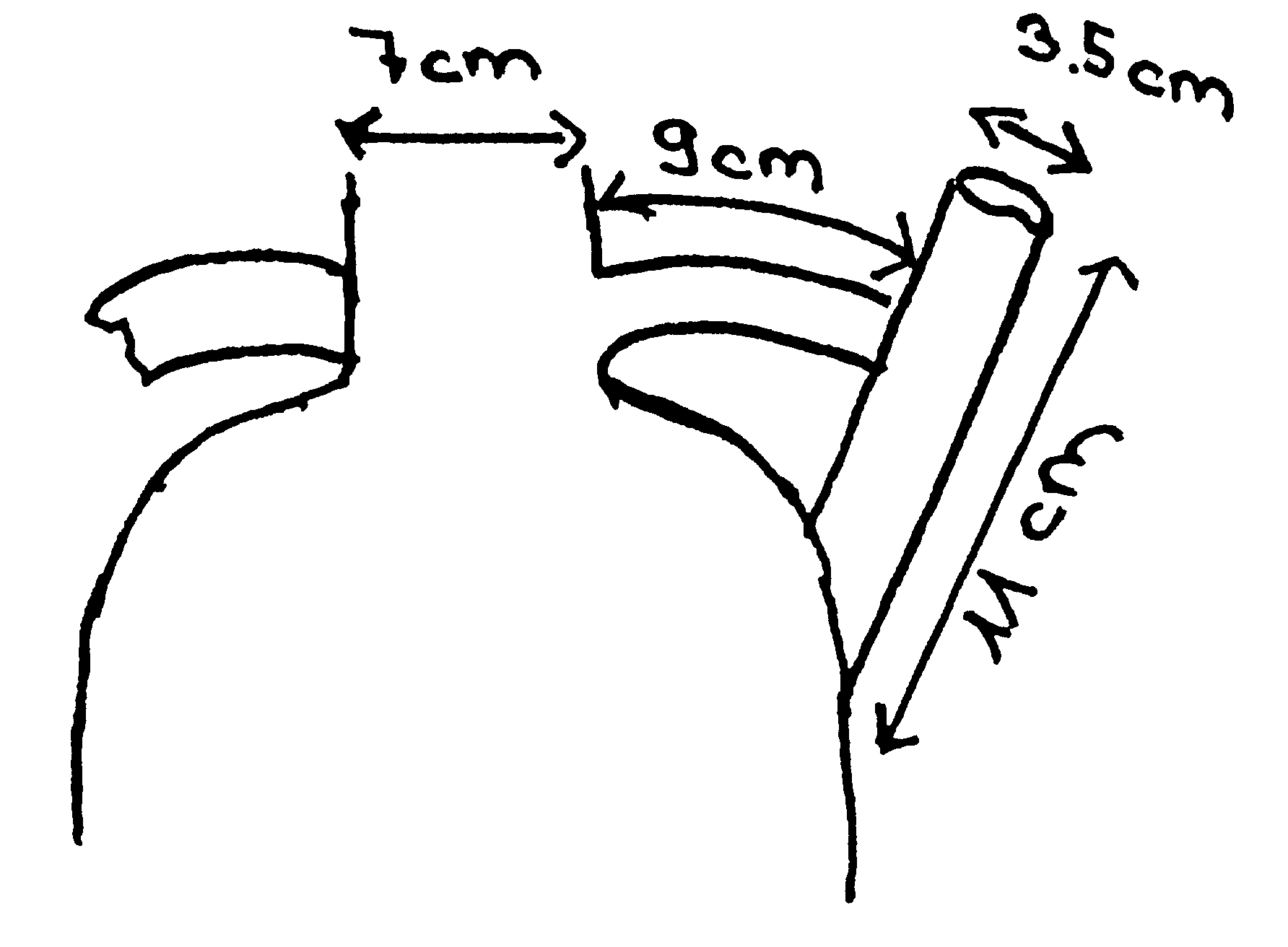 |
Wracks im östlichen Mittelmeer während Tausenden von Jahren...
Durch die lange Besiedelung und den intensiven Handelswege, werden im östlichen Mittelmeer Tausende - zum Teil noch unbekannte - Schiffswracks vermutet. Das geschulte Auge erkennt viele mögliche Aufschlagspunkte, welche als mögliche Wrackstellen in Frage kommen. Jedes dieser Schiffe besitzt eine einzigartige Geschichte hinter der sich lange vergessene Katastophen und Tragödien verbergen...
In dieser Projektwoche durften die Teilnehmer unter sachkundiger Leitung von Askin Canbazoglu und Rico Rampinelli erfahren, was es heisst an einem Fundplatze erste Untersuchungen anzustellen. Bei den beobachteten Untersuchungen konnten weit mehr Details erkannt werden, als zunächst vermutet. Die Diskussionen im Team brachten oft erst die entscheidenden Hinweise! Gleichzeitig wurde auch allen Teilnehmern klar, dass zur wissenschaftlichen Auswertung ein x-fach grösserer Aufwand notwendig wäre, ein solcher Workshop aber wertvolle Informationen vermitteln kann, die ohne das freiwillige Engagement nicht möglich wären.
Wir hoffen das Wrackstellen wie diese, den zur Erhaltung notwendigen Schutz erhalten, ohne dass Tauchverboten. ausgesprochen werden müssen! Gezielte Information soll zu diszipliniertem Verhalten der Sporttaucher führen. Regelmässige Gepäck-Kontrollen durch Tauchbasen, Küstenwache und Zollabfertigung wachen über die Einhaltung des Kulturgüterschutzes!
Wir danken Askin Canbazoglu und seinem Team von der Tauchbasis ASKIN Diving für Ihre Unterstützung.
Enrico Rampinelli danken wir für die excellente Kurs Vorbereitung und Leitung. Ohne seinen unermüdlichen Einsatz für die Unterwasser-Archäologie wären solche Workshops kaum möglich.
Besonders danken möchten wir Dr. Georges Bass, Präsident der INA, dass er sich die Zeit genommen hat uns Laien einen tieferen Einblick zugeben, anlässlich der Führung durch das wunderbare Unterwasser- Archäologische Museum von Bodrum.