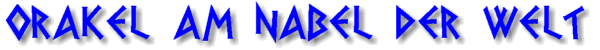|
|
||||
| Der Gründungsmythos von Delphi berichtet, dass Zeus, um die Mitte der Erde zu finden, an ihren Enden zwei Adler aufsteigen ließ. Beide flogen gleich schnell aufeinander zu, trafen sich und landeten an der Stelle mitten im Heiligtum von Delphi, wo später der Omphalos (ÑmfalÒj) stand, der "Nabel der Welt". Ursprünglich war er ein heiliger Stein, ähnlich einem Menhir oder dem Stein der Aphrodite in Paphos, und der Gaia geweiht – ein Kultmal also, das in einfacher Form, ohne ein Götterbild zu sein, die Anwesenheit einer Gottheit anzeigt und mit einem Wort phönizischer Herkunft Baitylos (ba…tuloj, baitu-lilah, "Wohnsitz einer Gottheit") heißt. Es gab viele solche Steine in Griechenland. Der griechische "Hinkelstein" war aber, wie jedes Kultmal, zugleich Zentrum des Temenos (tšmenoj, fanum) und damit axis mundi, die rituelle Mitte der Welt, die Götter und Menschen verbindet. Jeder Mittelpunkt eines Kultortes ist in diesem Sinn das Zentrum des Kosmos. | ||||
 |
||||
| Weihegeschenk aus Delphi, das den mit Wollgirlanden geschmückten Omphalos darstellt, heute im Museum von Delphi. In der Mitte des heiligen Bezirks steht eine weitere, einfache antike Nachbildung des Omphalos. Der Originalstein, der seit vorgeschichtlicher Zeit verehrt wurde und im Tempel Apollons stand, wurde nicht gefunden. | ||||
| Einzigartig am delphischen Omphalos ist, dass er diese Funktion der heiligen Mitte für ganz Griechenland, ja für die ganze den Griechen bekannte Welt einnehmen konnte. Er verdankt das natürlich dem Orakel des Apollon, dessen unfehlbare Weissagungen im ganzen Mittelmeerraum und darüber hinaus berühmt waren und gleichermaßen von Griechen und "Barbaren" eingeholt wurden: von Römern und Etruskern, vom lydischen König Kroisos, der das Orakel missverstand und in sein Verderben rannte, und vom ägyptischen Pharao Amasis, der den Wiederaufbau des 548 BCE abgebrannten Tempels mitfinanzierte. Apollon beriet Könige und Stadtregie-rungen, aber auch kleine Leute in alltäglichen Fragen – darüber etwa, ob es "besser und heilsamer" (lîion kaˆ ¥meinon) sei, sich zu verheiraten, einen Garten anzulegen, Streitfälle auszutragen oder sich zu vergleichen. Er enthüllte die Ursachen von Problemen, reinigte von Fluch und Schuld, gab religiöse Anleitungen und inspirierte die Gesetzgeber, weihte die Verfassungen der Städte und beflügelte die Dichter und Philosophen. Seine größte geschichtliche Bedeutung aber erreichte das Orakel von Delphi durch die Auswanderer der archaischen Zeit, denen es ihre neuen Wohnsitze von Spanien bis ins Schwarze Meer zuwies. Von den Griechenstädten, die dort überall im Zeichen des delphischen Apollon entstanden, breitete sich sein Ruhm aus. | ||||
| Das Ende des Orakels wird von einer wehmütigen Legende in die Regierungszeit des Kaisers Julianus (361 - 363 CE) verlegt, der die unter Konstantin und seinen Söhnen geschändeten Heiligtümer erneuerte und im Krieg gegen die Perser durch einen römischen Speer fiel. Er soll den Arzt Oreibasios nach Delphi geschickt und die Antwort erhalten haben: | ||||
|
Kündet dem Herrscher: Zu Boden gestürzt ist die heilige Halle, |
||||
| Tatsächlich wurden Orakel und Kult des Apollon erst eine Generation später, 394 CE, von Theodosius verboten. Die Feinde Delphis bezweifelten keineswegs seine Orakelkraft. Sie hielten aber die Götter für Dämonen, die man nicht anbeten sollte, und bemühten sich daher, die Weissagungen nicht Apollo, sondern allein dem Pneuma (pneàma) zuzuschreiben, das aus dem Schlund der Erde (c£sma gÁj, chasma ges) in den Tempel strömte. Damit widersprachen sie den Philosophen, die in der Inspiration der Pythia eine harmonische, unter der Schutzherrschaft Apollons und der Musen vollzogene Verbindung zwischen der irdischen Kraft des Pneuma und dem himmlischen Einfluss der Sonne erkannt hatten. Da sie aber nur das Pneuma für wirksam hielten, behaupteten sie, die Weissagungen Delphis seien kein Vorrecht Apollons, sondern eine dämonische Eigenschaft des Ortes selbst. | ||||
| Denn das Pneuma ist nicht, wie spätere Schriftsteller glaubten, ein inspirierendes Gas, das aus einem Felsspalt austrat, denn es gibt in Delphi weder einen solchen Spalt noch die geologischen Voraussetzungen für eine Gasquelle. Vielmehr strömt es, wie Plutarchos erklärt, außer durch den Boden auch durch das Wasser der heiligen Quellen und ist, wie das Wort pneàma überhaupt oft einen abstrakten Sinn hat, eine göttliche Kraft, die dem Ort innewohnt. Delphi erweist sich schon durch seine landschaftliche Schönheit – denn Schönheit ist für die Griechen stets ein Beweis für die Anwesenheit des Göttlichen – als ein natürlicher Kraftort, dessen Qua-lität nicht zu übersehen ist. Sein Pneuma wurde bereits von den "pelasgischen" Ureinwohnern erkannt, die das erste Heiligtum Delphis der Mutter Erde weihten. Die "achäischen" Einwanderer setzten ihren Kult fort, bis schließlich Apollon kam und das Heiligtum in Besitz nahm – doch nicht nur das: Er hat seinen Charakter nachhaltig verändert. | ||||
| Die Bedeutung, die Apollon als nicht nur weissagender, sondern auch reinigender, heilender, Dichter und Weise inspirierender, gesetzgebender und ordnungstiftender Gott dem Heiligtum von Delphi gegeben hat, geht über die magische Kraft des Ortes hinaus. Sie ist das Vorrecht Apollons, das auch von denjenischen Philsoophen, die sonst die Worte der Dichter und Seher bezweifeln, ausdrücklich anerkannt und bestätigt wird. So fragt Platon in seiner Politeia: „Was bleibt vom Werk der Gesetzgebung für uns noch zu tun?" Und er lässt Sokrates antworten: „Uns bleibt nichts mehr zu tun, wohl aber Apollon, dem Gott von Delphi. Ihm obliegen unsere wichtigsten, schönsten und grundlegendsten Gesetzesverordnungen, die sich auf den Bau der Tempel, die Opfer, den Kult im allgemeinen – sowohl der Götter als auch der Daimones und Heroen – auf die Gräber der Verstorbenen und auf all unsere Verpflichtungen ihnen gegenüber beziehen, damit sie uns wohlgesonnen sind. Dies sind Dinge, die wir nicht kennen, und wenn wir gut beraten sind, werden wir bei der Gründung einer Stadt keiner anderen Stimme Gehör schenken. Wir werden uns auch an keine anderen Exegeten als die unserer Vorväter wenden. Sicherlich ist der Gott in diesen Fragen der Exeget der Vorfahren für die ganze Menschheit. Er, der seinen Sitz am Mittelpunkt der Erde hat, gibt seine Auslegungen dort, wo sich ihr Nabel befindet." | ||||