
|
|
 Schulprogramm
Schulprogramm  Erziehung
Erziehung |
|
|
Streitschlichtung/soziales Lernen |
|
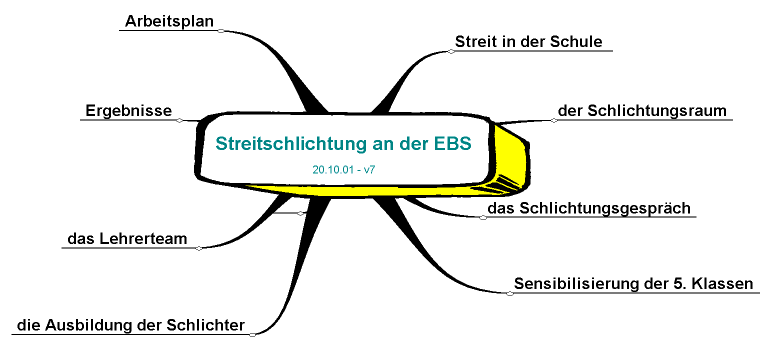
|
|
|
Streit in der Schule oder Kennen Sie das? „Auch das noch, ich hab keine Zeit“, überlegt Frau Müller fieberhaft. Ich habe Aufsicht auf dem Schulhof und muss für die nächste Stunde noch schnell Kopien machen. Soll ich die Aufsicht vernachlässigen? Nein, das geht nicht. Wenn auf dem Schulhof was passiert, werde ich zur Verantwortung gezogen. Dann muss ich das Gespräch mit den Jungs auf später verschieben. Ach, das geht ja auch nicht. Heute findet direkt nach der 6. Stunde die Erprobungsstufenkonferenz statt.“ Frau Müller seufzt und wirft den beiden einen strengen Blick zu. „Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Aber wir sprechen uns noch.“ Und schon ist sie auf dem Weg zum Lehrerzimmer. Thomas und Jan beschimpfen sich weiter. Viel fehlt nicht mehr und die beiden gehen mit Fäusten aufeinander los .Thomas überlegt gleichzeitig verzweifelt, wie er seiner Mutter den Klassenbucheintrag erklären soll. Und Jan hat Angst, den Füller wirklich ersetzen zu müssen. Sein Taschengeld ist für diesen Monat schon fast aufgebraucht. Was tun? Seit dem Schuljahr 1999/2000 haben die Schülerinnen und Schüler der Ernst-Barlach-Schule die Möglichkeit, solche und andere Konflikte mit Hilfe der Streitschlichter zu klären. Der Schlichtungsraum
In der Ernst-Barlach-Schule gibt es einen speziellen Raum, den Schlichtungsraum,
in dem sich jeweils zwei Schlichter in den großen Pausen aufhalten. Schülerinnen
und Schüler, die freiwillig einen Streit mit Hilfe der Schlichter klären
wollen, kommen in diesen Raum und vereinbaren einen Gesprächstermin, z.B.
für den nächsten Tag in der ersten großen Pause.oder Wie kommen die Streithähne mit den Schlichtern in Kontakt? Vorher haben sich die Streitenden an der Fotowand ihre „Wunsch-Schlichter“ ausgesucht. Natürlich werden auch die zuständigen Lehrer befragt, denn es kann sein, dass ein Schlichtungsgespräch über die Pause hinausgeht. Gegebenenfalls muss ein Termin auch schon einmal verschoben werden, wenn vielleicht gerade eine Klassenarbeit geschrieben werden soll. Das Schlichtungsgespräch
Ein Schlichtungsgespräch verläuft in folgenden Abschnitten:oder Was passiert eigentlich bei der Schlichtung? 1. In der Einleitung stellen sich die beteiligten Personen gegenseitig vor, die Schlichter erklären die Gesprächs- und Schlichtungsregeln. 2. Es folgt die Darstellung des Konflikts, wobei beide Streitenden die Möglichkeit haben zu erzählen, wie sich der Konflikt aus ihrer Sicht darstellt. 3. Anschließende geht es um die Bearbeitung des Konflikts. Die Schlichter versuchen zu erhellen, worin die persönliche Bedeutung des Konflikt für die Streitenden besteht. 4. Danach werden Lösungen gesucht. Jedes Kind schreibt auf, welche Lösungen es sich für den Konflikt wünscht und was es selbst dazu beisteuern kann, z.B. eine Entschuldigung oder eine andere Form der Wiedergutmachung. 5. In der Phase der Einigung und des Abschlusses geht es darum, sich auf gemeinsame Lösungen zu verständigen, die Einigung schriftlich festzuhalten und unterschreiben zu lassen. Schließlich wird ein weiteres Treffen vereinbart, um die Einhaltung der Vereinbarungen zu überprüfen. Sensibilisierung der 5. Klassen
Es sind vor allem die Schüler der unteren Jahrgänge, die die Schlichter
aufsuchen. In den höheren Klassen sind die Schüler zunehmend in der Lage,
auftretende Konflikte selbständig zu klären.oder Wie werden die jüngeren Kinder auf diese Art der Konfliktbewältigung vorbereitet? Jedes Jahr im Herbst werden alle 5. Klassen im Verlauf eines Projekttages mit der Streitschlichtung vertraut gemacht. Dieser Tag findet außerhalb der Schule statt und ist „Unterricht – einmal anders.“ Die Kinder versetzen sich in Rollenspielen in verschiedene Streitsituationen und machen sich dabei bewusst, dass Streiten verletzt und wirklich schaden kann, wenn Konflikte nicht geklärt werden. Schließlich lernen sie die Einrichtung der Streitschlichtung kennen und erhalten Einblick in Regeln und den Ablauf eines Schlichtungsgespräches. Diese Informationen erhalten sie aus „erster Hand“, denn an solchen Projekttagen sind zwei bis drei ausgebildete Streitschlichter anwesend. Sie unterstützen die Kinder und beantworten anfallende Fragen. Dieser Tag dient zunächst der Einführung und der Sensibilisierung der Kinder für das Thema. In den Klassenlehrerstunden und in den Stunden „Soziales Lernen“ wird die Problematik erneut aufgegriffen und vertieft. Und schließlich sind die täglichen Streitsituationen in der Klasse immer wieder ein Training zur friedlichen Konfliktbewältigung. Die Ausbildung der Schlichter
oder Was man alles lernen muss Am Ende des 8. Schuljahres werden die älteren Schüler auf ihre Rolle als mögliche Streitschlichter vorbereitet. Jede Klasse führt wiederum einen Projekttag außerhalb der Schule durch, diesmal jedoch aus einem anderen Blickwinkel. Es geht für die Schülerinnen und Schüler darum, den Ablauf eines Schlichtungsgespräches kennen zu lernen und durch verschiedene Übungsformen zu erfahren, welche Anforderungen an die Streitschlichter gestellt werden, z.B. neutral zu sein, zuhören zu können, sich einfühlen zu können. Am Ende des Tages sollen die Jugendlichen beurteilen und entscheiden können, ob sie die Aufgaben eines Schlichters übernehmen wollen oder nicht. Schülerinnen und Schüler, die sich zu Streitschlichtern ausbilden lassen wollen, wählen dann für das 9. Schuljahr die AG „Streitschlichtung“, die wöchentlich 2 Stunden als Pflicht- oder freiwillige AG angeboten wird. Hier machen sie sich zunächst Gedanken zu den Themen Konflikte und Aggressionen, trainieren dann verschiedene Gesprächssituationen und reflektieren ihre Erfahrungen aus den Schlichtungsgesprächen. Rollenspiele und Videounterstützung sind dabei eine unerlässliche Hilfe. Die Ausbildung der Streitschlichter ist zu sehen als Teil eines sozialen Kompetenztrainings (siehe: Soziales Lernen und Suchtprävention). Die Schlichter haben die Möglichkeit, Verantwortung für ihre Mitschüler und das Zusammenleben in der Schule zu übernehmen. Im Verlauf der Ausbildung und der Schlichtungsgespräche lernen sie ganz konkret, ein Gespräch zu moderieren, dabei wertfrei und geduldig zuzuhören, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, ihre Gefühle und Standpunkte zu erkennen und zusammenzufassen und die Mitschüler zu konstruktiven Lösungen anzuleiten. Mit ihrer eigenen Meinung müssen sie sich dabei zurückhalten können. Das Lehrerteam
oder Wer leitet das alles denn an? Im Schuljahr 1998/99 hat eine sechsköpfige interessierte Gruppe des Kollegiums an einer Fortbildung zum Thema Streitschlichtung teilgenommen und sich seitdem mit diesem Konzept vertraut gemacht. Dabei war vor allem die Zusammenarbeit mit der Adolf-Reichwein-Schule in Sennestadt, an der die Streitschlichtung seit mehreren Jahren praktiziert wird, bereichernd. Durch gegenseitige Hospitationen und regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch haben sich die Kollegen fortgebildet und schließlich in zahlreichen Sitzungen ein Konzept für die EBS entworfen. Inzwischen sind neue Kollegen dazugekommen und das ursprüngliche Konzept für die Projekttage wurde überarbeitet. Ergebnisse
Eine systematische Auswertung und Evaluation der Streitschlichtung, ihrer
Erfolge und Ergebnisse für die Schule als Ganzes, aber auch ihrer möglichen
Schwachstellen ist eine der nächsten Aufgaben der Lehrer Arbeitsgruppe.oder Und bringt das alles überhaupt etwas? Bisher können wir aufgrund unserer Erfahrungen sagen, dass die Streitschlichter vor allem von den Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klassen angefragt werden. Die Kinder sind dankbar für die Möglichkeit eines ruhigen Gespräches und für die Hilfe älterer, neutraler Mitschüler. Es ist auch der Eindruck entstanden, dass sich das Schulklima verbessert hat. Nicht die Anzahl der Konfliktfälle hat sich verändert, sondern die Schülerinnen und Schüler sind zunehmend in die Lage versetzt worden konstruktiv und eigenverantwortlich in Streitfällen zu handeln. |
|