K. Höfig
Tecklenburg, den 13.1.1998
Thema: Utilitaristische Ethiken und Kants deontologische Ethik
I.
Vorbemerkung
Die ethische Analyse menschlichen Handelns muß auf zwei Dinge schauen:
a. Woher kommt das Motiv für das Handeln
b. Welches Universalisierungsprinzip wird verwendet
Beispiel: Am Dienstag, den 13.1.1998 versammeln
sich 25 Menschen in der Stadthalle in Hiltrup. Für dieses (auffällige)
Verhalten muß es eine
Begründung geben. Da die Motive wahrscheinlich ganz
unterschiedliche sind, kann deren Betrachtung allein ja nicht für die Erklärung
ausreichen.
Mögliche Begründungsmuster für normative Ethiken
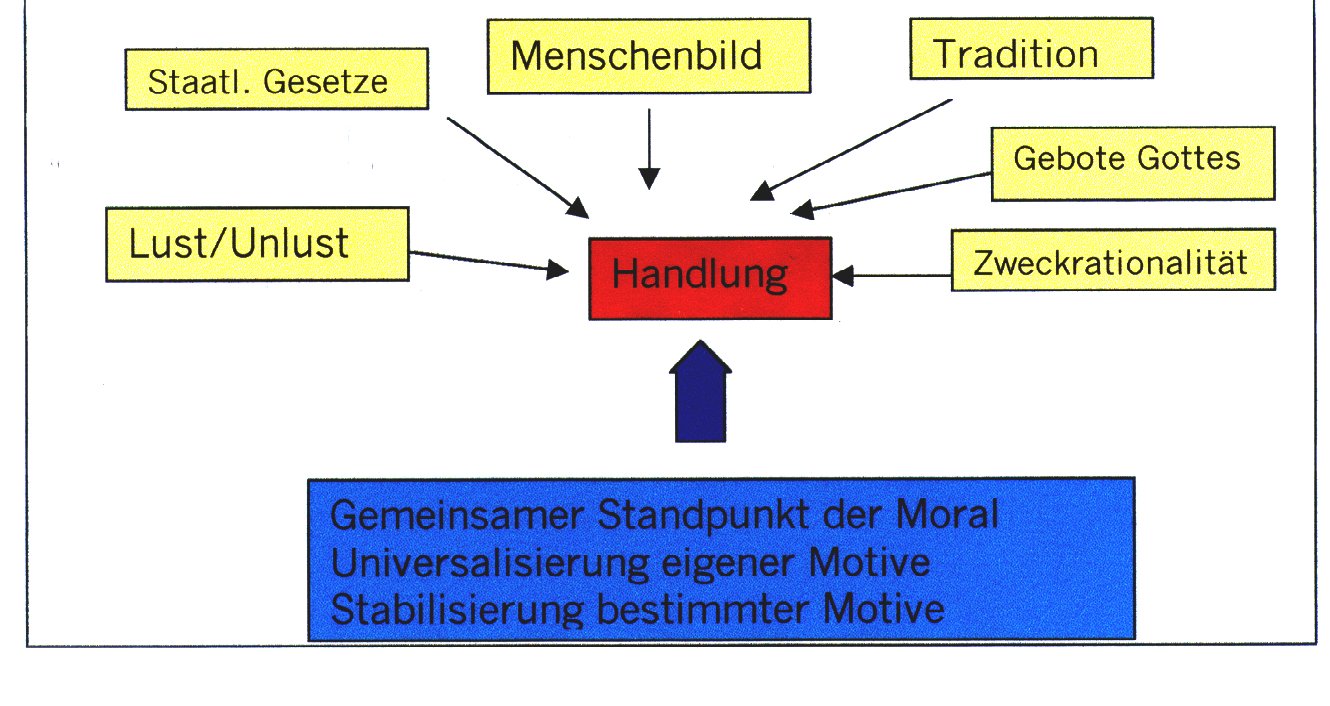
Mögliche Ethiken
Der
Utilitarismus als Beispiel einer ausgearbeiteten ethischen Theorie
Normen
brauchen -wie oben dargestellt- eine allgemeine Anerkennung, d.h. für die
rationale Begründung einer Ethik muß ich Handlungsmotive finden, die
durchgängig akzeptiert sind.
Bentham (1748-1832): "Die
Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveräner Gebieter - Leid
und Freude - gestellt. Es ist an ihnen allein aufzuzeigen, was wir tun
sollen, wie auch zu bestimmen, was wir tun werden."
Maßstab
für das Handeln ist der allgemeine Nutzen.
Bentham
richtet sich damit gegen die Autorität der Kirche und gegen die Privilegien der
Herrschenden.
"Das Prinzip der
Nützlichkeit erkennt dieses Joch (der Herrschaft von Leid und Freude) an und
übernimmt es für die Grundlegung jenes Systems, dessen Ziel es ist, das Gebäude
der Glückseligkeit durch Vernunft und Recht zu errichten."
Das
Universalisierungsprinzip (Berechnung der Nützlichkeit)
Eine
Handlung ist dann gut, wenn das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl
erreicht wird.
Konsequenzen bei Bentham:
ð
moralisches
Handeln soll wissenschaftlich gerechtfertigt werden
ð
Geringschätzung
menschlicher Freiheit
ð
Poesie
ist nicht wertvoller als Kegeln, wenn Poesie kein höheres Maß an Freude bringt
(vergl. Vorwürfe an Epikur)
ð
auch
die Menschenrechte / Naturrechte sind metaphysisch und romantisch
John Stuart Mill
(1806-1873) Berücksichtigung der Qualität des Nützlichen
"Die
Anerkennung der Tatsache, daß einige Arten der Freude wünschenswerter und
wertvoller sind als andere, ist mit dem Nützlichkeitsprinzip durchaus
vereinbar. Es wäre unsinnig anzunehmen, daß der Wert einer Freude
ausschließlich von der Quantität abhängen sollte, wo doch in der Wertbestimmung
aller anderen Dinge neben der Quantität auch die Qualität Berücksichtigung
findet."
ðProblem: Wie läßt sich hier zeigen, daß eine Handlung, die zunächst keine
Freude macht, vielleicht sehr lange Zeit erst mehr Unannehmlichkeiten bringt,
dennoch richtig ist?
"Darüber,
welche von zwei Befriedigungen es sich zu verschaffen am meisten lohnt oder
welche von zwei Lebensweisen ungeachtet ihrer moralischer Eigenschaften und
ihrer Folgen dem menschlichen Empfinden am meisten zusagt, kann nur das Urteil
derer, die beide erfahren haben, oder, wenn sie auseinandergehen sollten, das
der Mehrheit unter ihnen als endgültig gelten." (Bei Platon entscheiden
darüber die Philosophen!)
Handlungsutilitarismus - Regelutilitarismus
Im Handlungsutilitarismus wird die Richtigkeit einer
Handlung von ihren Folgen her beurteilt.
Bentham: Jede einzelne Handlung wird auf
diese Weise betrachtet
Mill: Es wird der Nutzen
einer Klasse von Handlungen betrachtet
Peter Singers
Präferenzutilitarismus
Im Präferenzutilitarismus ist nicht nur die Lust,
sondern sind Präferenzen (Wünsche und Interessen, Neigungen aller bewußten
Wesen) überhaupt die Grundlage für moralische Entscheidungen.
An einem Beispiel soll die Argumentationsweise des
Präferenzutilitarismus verdeutlicht werden.
Das zentrale Argument gegen die Abtreibung läßt sich formal etwa folgendermaßen darstellen:
Erste Prämisse: Es ist falsch, ein unschuldiges menschliches Wesen zu töten.
Zweite Prämisse: Ein menschlicher Fötus ist ein unschuldiges menschliches Wesen.
Schlußfolgerung: Daher ist es falsch, einen menschlichen Fötus zu töten.*
Um zu zeigen, daß dieser (formal korrekte) Schluß zu einem inhaltlich falschen Ergebnis führt, mußte die liberale Antwort in dem Nachweis liegen, daß mindestens eine der beiden Prämissen falsch ist. So fährt Singer fort.-
Üblicherweise besteht die liberale Antwort darin, daß man die zweite Prämisse dieses Arguments bestreitet. So kommt es, daß das Problem mit der Frage verbunden wird, ob der Fötus ein menschliches Wesen ist, und die Diskussion um die Abtreibung wird oft als eine Diskussion darüber begriffen, wann menschliches Leben beginnt.
Welches Kriterium der Abtreibungsverteidiger auch wählt, eine iiberzeugende Trennungslinie zwischen einer empfindungslosen Zellenansammlung und menschlichem Leben gibt es nicht, die Entwicklung von der befruchteten Eizelle zum menschlichen Lebewesen ist stufenlos. Deshalb hält Singer die zweite Prämisse der Konservativen für unangreifbar und wendet sich der ersten Prämisse zu:
Die Schwäche der ersten Prämisse des konservativen Arguments hegt darin, daß sie auf
unsere Billigung des besonderen
Status des menschlichen Lebens angewiesen ist. Wir
menschlichen Lebens angewiesen ist. Wir
haben gesehen, daß der Begriff "menschfich" zwischen verschiedenen Bedeutungen
schwankt: "Nfitglied der Gattung Homo sapiens" einerseits und Person andererseits. Ist
der Begriff erst einmal auf diese Weise aufgespalten, so wird die Schwäche der ersten Prämisse augenfällig. Wird "menschlich" als Äquivalent für "Person" genommen, dann ist die zweite Prämisse des Arguments, die Behauptung, der Fötus sei ein menschliches Wesen, nüt Sicherheit falsch; denn man kann nicht plausibel argumentieren, der Fötus sei entweder rational oder selbstbewußt. Nimmt man andererseits "menschlich" in der Bedeutung von "Mitglied der Spezies Homo sapiens", dann beruht die konservative Verteidigung des Lebens des Fötus auf einer Eigenschaft, die keine moralische Bedeutung hat, und somit ist die erste Prämisse falsch. Dieser Punkt sollte uns jetzt allmählich vertraut sein: ob ein Wesen ein Mitglied unserer Spezies ist oder nicht, ist für sich genommen für die Verwerflichkeit des Tötens ebenso unerheblich wie die Frage, ob es ein Mitglied unserer Rasse ist oder nicht. Die Auffassung, die bloße Zugehörigkeit zu unserer Spezies, ungeachtet aller anderen Eigenschaften, sei von entscheidender Bedeutung für die Verwerflichkeit des Tötens, ist ein Erbe religiöser Lehren, die selbst die Gegner der Abtreibung nurmehr zögernd ins Gespräch bringen.
Diese einfache Erkenntnis verändert die Abtreibungsdiskussion. Wir können den Fötus nun als das betrachten, was er ist - die wirklichen Eigenschaften, die er besitzt -, und können sein Leben nach demselben Maßstab bewerten wie das Leben von Wesen, die ähnliche Eigenschaften haben, aber nicht zu unserer Spezies gehören. Es wird nun offensichtlich, daß die "Rechtauf-Leben"-Bewegung einen falschen Namen hat. Weit entfernt davon, sich für jedes Leben einzusetzen oder sich einzusetzen in einem Ausmaß, das sich ohne Voreingenommenheit nur nach der Natur des fraglichen Lebens begrüßt, zeigen diejenigen, die gegen Abtreibung protestieren, jedoch regelmäßig das Fleisch von Hühnern, Schweinen und Kälbern verspeisen, nur ein vordergründiges Interesse am Leben von Wesen, die zu unserer Spezies gehören. Denn bei jedem fairen Vergleich moralisch relevanter Eigenschaften wie Rationalität, Selbstbewußtsein, Bewußtsein, Autonomie, Lust- und Schrnerzempfindung und so weiter haben das Kalb, das Schwein und das viel verspottete Huhn einen guten Vorsprung vor dem Fötus in jedem Stadium der Schwangerschaft - und wenn wir einen weniger als drei Monate alten Fötus nehmen, so würde sogar ein Fisch, ja eine Garnele mehr Anzeichen von Bewußtsein zeigen. Ich schlage daher vor, dem Leben eines Fötus keinen größeren Wert zuzubilligen als dem Leben eines nicht menschlichen Lebewesens auf einer ähnlichen Stufe der Rationalität, des Selbstbewußtseins, der Wahrnehmungsfähigkeit, der Sensibilität etc. Da kein Fötus eine Person ist, hat kein Fötus denselben Anspruch auf Leben wie eine Person. Ferner ist es sehr unwahrscheinlich, daß Föten von weniger als, achtzehn Wochen überhaupt fähig sind, etwas zu empfinden, weil ihr Nervensystem allem Anschein nach noch nicht genug entwickelt ist. Wenn das so ist, dann beendet eine Abtreibung bis zu diesem Datum eine Existenz, die überhaupt keinen Wert an sich hat. In der Zeit zwischen achtzehn Wochen und der Geburt, wenn der Fötus vielleicht bewußt, aber nicht selbstbewußt ist, beendet die Abtreibung ein Leben, das einen gewissen Wert an sich hat, und somit sollte sie nicht leichtgenommen werden. Aber die schwerwiegenden Interessen einer Frau haben normalerweise den Vorzug gegenüber den rudimentären Interessen des Fötus.
Immanuel Kant
Kants Ethik muß man als den Versuch begreifen,
Freiheit überhaupt zu retten, nachdem er in der und durch die "Kritik der
reinen Vernunft" gezeigt hat, daß in der Welt der Erscheinungen ein
unlösbarer Widerstreit zwischen Freiheit und Kausalität existiert.
Freiheit ist
eine transzendentale Idee der Vernunft.
Freiheit ist
Unabhängigkeit von der Nötigung durch Antriebe der Sinnlichkeit
Praktische
Freiheit ist diejenige, in welcher die Vernunft nach objektiv bestimmenden
Gründen Kausalität hat.
Vernunft an
sich ist stets frei und kann nicht durch Sinnlichkeit bestimmt werden.
Der Mensch
kann sich unabhängig von sinnlichen Antrieben durch Vernunftprinzipien selbst
bestimmen.
Vernunftgesetze
sind dadurch gekennzeichnet, daß sie mit absoluter Notwendigkeit und strenger
Allgemeinheit gedacht werden (d.h. a priori).
Wenn man jetzt
etwas sucht, das uneingeschränkt für gut gehalten werden kann, dann ist das
allein ein guter Wille.
"Es ist überall nichts in der Welt, ja
überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für
gut
könne gehalten werden, als allein ein guter
Wille."
"Der gute Wille ist nicht durch das, was er
bewirkt oder aus-
richtet, nicht durch seine Tauglichkeit zu
Erreichung irgend eines
vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das
Wollen, d.i. an sich
gut."
-
Der
Pflichtbegriff bei Kant
-
-
Um
weiter zu verdeutlichen, was den guten Willen ausmacht, benutzt Kant den
Begriff der Pflicht.
-
Das
Reich der Vernunft ist durch Gesetze gekennzeichnet (strenge Allgemeinheit und
Notwendigkeit).
-
Pflicht
ist es, diesen Gesetzen zu gehorchen, d.h. genauer Handlungen aus Pflicht
(nicht nur pflichtgemäß) zu vollbringen.
-
Alle
Handlungen sollen aus Pflicht geschehen.
-
Eine
Handlung aus Pflicht hat ihren moralischen Wert nicht in der Absicht, welche
erreicht werden soll, sondern in der Maxime, nach der sie beschlossen ist.
-
Pflicht
ist Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung vor dem Gesetz.
Achtung deshalb, weil es ein
Vernunftgesetz ist, das jedes autonome Wesen erkennen kann.
Da Menschen nun auch (bzw. vor allem) durch Neigungen
bestimmt sind, brauchen sie (anders als reine Vernunftwesen), braucht der Wille
Imperative um das Handeln bestimmen zu können.
Die Formen des kategorischen
Imperativs:
Ein Imperativ drückt ein Sollen aus und zeigt
dadurch das Verhältnis eines objektiven Gesetzes der Vernunft zu einem Willen
an.
Handle
nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein
allgemeines Gesetz werde.
Handle
so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines
jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.