Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Fakultät für Maschinenwesen
Institut für Dampf- und Gasturbinen der RWTH Aachen
Prof. Dr.-Ing. Dieter Bohn
in Zusammenarbeit mit der
Firma ENERCON GmbH, Aurich
Machbarkeitsstudie und Konzept einer
stationären Schwungradanlage zur dezentralen, verbraucherorientierten Energiespeicherung
Diplomarbeit
Aachen, im Mai 1996
Autor: cand.-Ing. Florian Strößenreuther
Betreuender wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Uwe Krüger
Betreuender Professor: Prof. Dr.-Ing. Dieter Bohn
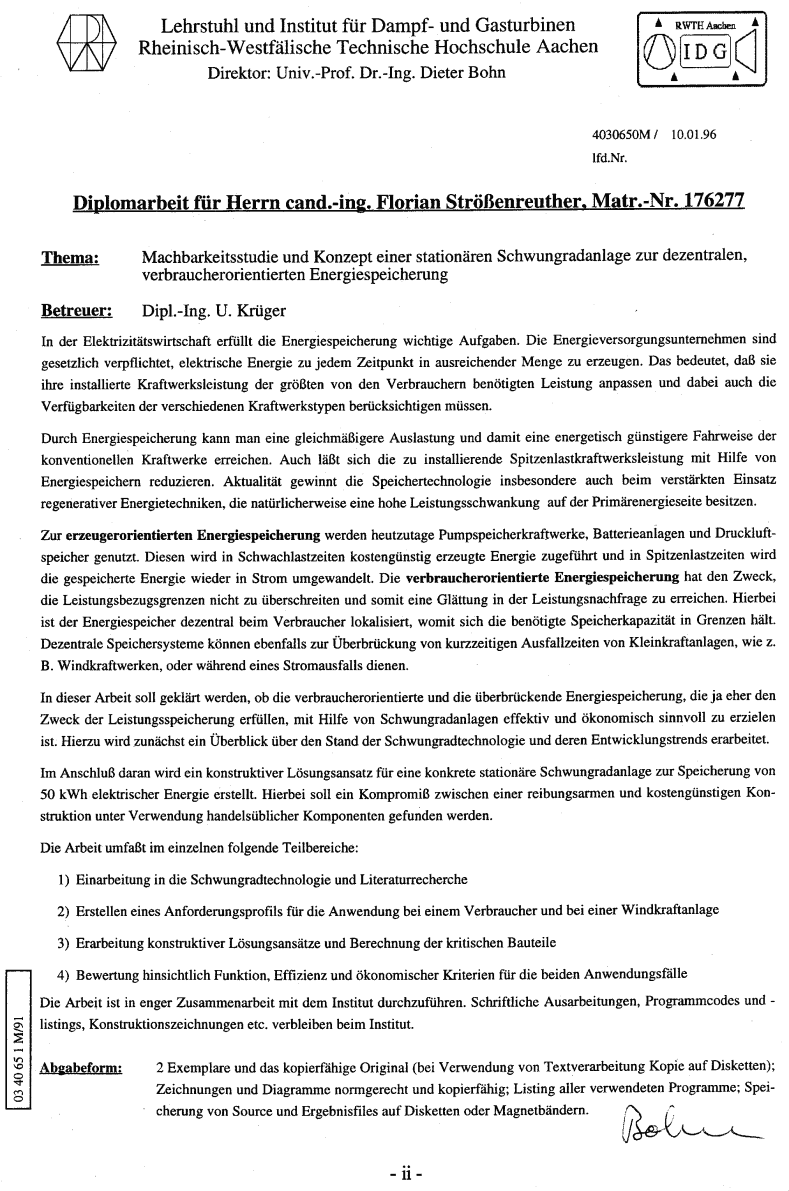
Erklärung
Hiermit erkläre ich, daß ich diese Diplomarbeit selbständig und ohne Hilfe Dritter angefertigt habe. Ich habe nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt, wobei ich die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen und Darstellungen als solche kenntlich gemacht habe.
Aachen, den 14. Mai 1996 Florian Strößenreuther
Danksagung
Ich möchte folgenden Personen meinen Dank aussprechen, die die Durchführung dieser Diplomarbeit ermöglicht haben bzw. die mir mit Rat und Tat während der letzten Monate beiseite gestanden haben:
Prof. Dr.-Ing. Dieter Bohn und Dipl.-Ing. Uwe Krüger, Institut für Dampf- und Gasturbinen der RWTH Aachen, die die wissenschaftliche Betreuung der Diplomarbeit übernommen haben,
Dipl.-Ing. Torsten Jepsen von der Firma ENERCON GmbH, Aurich, der die Anregung zu dieser Diplomarbeit gab und mit dem ich in mehreren Gesprächen einen regen Gedankenaustausch hatte,
meinen Eltern, die mich das ganze Studium über moralisch und finanziell unterstützt haben,
meinen Freunden, die mir während der Diplomarbeitsphase zu willkommener Ablenkung verhalfen
und schließlich meiner Freundin Martina, die mich die letzten Monate immer wieder aufgemuntert und unterstützt hat.
Inhaltsverzeichnis
Diplomthema ii
Bezeichnungen vii
1 Einleitung 1
2 Geschichtlicher Rückblick 3
3 Schwungradentwicklung in den letzten vierzig Jahren 8
3.1 Ausgeführte und geplante Anlagen 8
3.2 Entwicklung 14
4 Grundlagen der Schwungradtechnik 17
4.1 Die Schwungradenergiespeicheranlage 17
4.2 Schwungradform 18
4.3 Werkstoffe 23
4.4 Lagerung 25
4.4.1 Wälzlager 26
4.4.2 Gleitlager 26
4.4.3 Magnetische Lager 27
4.4.4 Anordnung 28
4.5 Gehäuse und Vakuum 30
4.6 Elektrischer Anlagenteil 33
4.6.1 Elektrische Maschine 33
4.6.2 Umrichter 34
4.7 Betriebsdatenerfassung und Regelung 36
5 Schwungrad als Energiespeicher 37
5.1 Energiefluß 37
5.2 Verluste 39
5.3 Wirkungsgrad und Speichergüte 42
5.4 Speicherstrategien 45
6 Weitere Speichermöglichkeiten 46
6.1 Allgemeines 46
6.2 Hydraulische Speicher 46
6.3 Thermische Speicher 47
6.4 Druckluftspeicher 48
6.5 Batterie 49
6.6 Wasserstofftechnologie 50
6.7 Supraleitender magnetischer Energiespeicher 51
6.8 Vergleich der verschiedenen Speichermöglichkeiten 52
7 Speichereinsatz in der elektrischen Energieversorgung 53
7.1 Ort der Energiespeicherung 53
7.2 Verbraucherorientierte Energiespeicherung 53
7.2.1 Kosten für die Energieumwandlung 54
7.2.2 Strompreise 55
7.2.3 Lastmanagement 57
7.3 Energiespeicherung bei Windkraftanlagen 60
7.3.1 Schwankungen des Windangebotes 60
7.3.2 Überbrückung bei Ausfall von Anlagen 62
7.3.3 Anschluß von Windkraftanlagen ans Netz 62
7.3.4 Netzstabilisierung, Frequenz- und Spannungsregelung 63
7.4 Weitere Anwendungen 64
7.5 Anforderungsprofil einer Schwungradenergiespeicheranlage 64
7.5.1 Anlagenspezifikation 64
7.6 Hypothetischer Lastzyklus 66
8 Entwurf einer Schwungradspeicheranlage 68
8.1 Zusammenhänge zwischen den Entwurfsbereichen 68
8.2 Schwungrad 69
8.2.1 Materialauswahl 69
8.2.2 Lebensdauer und Dauerfestigkeit 69
8.2.3 Festigkeitsberechnung 74
8.2.4 Schwungradform 83
8.2.5 Anordnung des Schwungrades 85
8.2.6 Verbindung Scheibe-Welle 86
8.2.7 Dynamische Betrachtung 87
8.3 Lagerung 87
8.3.1 Axiales hydrostatisches Gleitlager 88
8.3.2 Axiales Wälzlager 90
8.3.3 Auswahl des Axiallagers 94
8.3.4 Radiales Führungslager 95
8.3.5 Schmierung 95
8.4 Elektrischer Anlagenteil 96
8.5 Gehäuse 97
8.5.1 Luftreibung 97
8.5.2 Belastung des Gehäuses 98
8.5.3 Berstschutz 99
8.6 Regelung und Steuerung 99
9 Bewertung der Schwungradenergiespeicheranlage 101
9.1 Verbraucherorientierte Speicherung 101
9.1.1 Verhalten der Anlage 101
9.1.2 Wirtschaftliche Betrachtung 104
9.2 Energiespeicherung bei Windkraftanlagen 108
9.2.1 Wirtschaftliche Betrachtung 108
10 Zusammenfassung 109
11 Literatur 111
12 Anhang 116
Bezeichnungen
Lateinische Buchstaben
a Rißlänge
B geometrischer Parameter der Scheibe gleicher Festigkeit
Bf gleichbleibende jährliche Betriebs- und Instandsetzungskosten
Bn im n-ten Betriebsjahr anfallende unregelmäßige Ausgaben
b1 Größenbeiwert
b2 Oberflächenbeiwert
C dynamische Tragzahl
C Konstante
C Werkstoffkennwert nach Paris
Cm aerodynamischer Reibkoeffizient
dm mittlerer Lagerdurchmesser
E Elastizitätsmodul
E Energie
E jährliche Stromkosteneinsparung
ezul zulässige bezogene Unwucht
F Kraft
f0,1 Koeffizienten zur Berechnung der Lagerreibung
G Auswuchtgütestufe
H Druckverhältnis
h Lagerspalt des Gleitlagers
i Anzahl der Lager
i Zinsfuß
J Massenträgheitsmoment
K Formfaktor
Ki Funktion der Schwungradform und der Zylinderkoordinaten
L Lebensdauer
M Moment
m Masse
N Lastspielzahl
n doppelt logarithmische Steigung der Rißfortschrittskurve
n Drehzahl
P dynamisch äquivalente Lagerbelastung
P Leistung
Pn Saldo am Ende des n-ten Jahres
p Druck
p Lebensdauerexponent
![]() Wärmestrom
Wärmestrom
R Kraftkomponente der Tangentialkräfte in radialer Richtung
Re Reynoldszahl
r Radius
S Schadenssumme nach Miner
S Sicherheit
s jährliche Teuerungsrate des Strompreises
TG Speichergüte
t jährliche Teuerungsrate der Betriebskosten
t Zeit
v örtliche Radialverschiebung
Y Geometriebeiwert des Risses
y Scheibendicke
Z Fliehkraft
Griechische Buchstaben
a
Verhältnis von Kranzdicke zu Scheibendicke am Außenrandb
Verhältnis von Innen- zu Außenradiusd
Durchmesser der Kapillaree
Dehnungh
dynamische Viskositäth
Wirkungsgradj
Drehwinkell
geometrischer Parameter der Scheibenkonturl
Länge der Kapillaren
kinematische Viskositätn
Querkontraktionszahlx
Pumpenwirkungsgradr
Dichtes
Spannungc dimensionsloser Radius
w
WinkelgeschwindigkeitIndizes
0 statisch
0 Beginn des Zyklus
1 Radiallager
2 Traglager
10 10 % Ausfallwahrscheinlichkeit
a außen
a Ausschlag
a Jahr
aero aerodynamisch
ax axial
c kritisch
Dicht Dichtung
E Entladevorgang
el elektrisch
erf erforderlich
f fest
G Gestalt
g Gas
Hilf Hilfsaggregat
i innen
L Ladevorgang
Lager Lager
m Mittelwert
m Mittel-
max maximal
mech mechanisch
min minimal
Netz Netz
Öl ölgeschmiert
o Ober-
r radial
S Speichervorgang
Sch Schwell-
Schw Schwungrad
sp Speicher
T Tasche
t tangential
Um Umrichter
u Unter-
V Verlust
v Vergleich
W Wechsel-
Z Zufuhr
z Zug
zul zulässig
zurück zur Übersicht