Travels
to the
Nanoworld
Travels to the Nanoworld.
Miniature Machinery in Nature and Technology
Hardback: Perseus Books, Cambridge, MA, May 1999,
ISBN 0-306-46008-4, $ 25.95 , 254 + xiii pp.
Paperback: Perseus Books January 2001,
ISBN 0-738-20444-7, $ 16.00, 254 + xiii pp.
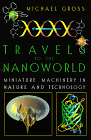
I. Einführung: Willkommen in der Nanowelt
Einen Motor, der nur einige hunderttausendstel Millimeter mißt und läuft und läuft und läuft. Einen Datenspeicher, der auf einem tausendstel Millimeter sieben Megabyte aufnehmen kann. Einen Katalysator, der den reaktionsträgen Stickstoff aus der Luft bei Zimmertemperatur und Atmosphärendruck in Ammoniak umwandeln kann.
Solche und ähnliche heute noch unerhörte Dinge mag sich manch einer von den Zukunftstechnologien erhoffen, die sich auf die der Größenskala im Nanometerbereich ansiedeln und deshalb unter dem Sammelbegriff "Nanotechnologie" zusammengefaßt werden. Die Vorsilbe "nano" heißt eigentlich nichts weiter als "ein milliardstel", oder, mathematisch ausgedrückt, 10--9. Ein Nanometer ist demnach ein milliardstel Meter oder ein millionstel Millimeter (Abb. 1).
Es geht also um komplizierte und leistungsfähige Maschinen, die nur einige millionstel Millimeter groß sein dürfen. Undenkbar? Keineswegs, denn die Evolution hat diese Aufgabe schon längst gelöst. Der Motor -- ein System aus den Proteinen Actin und Myosin -- treibt unsere Muskeln an. Der Datenspeicher -- ein Chromosom, d.h. ein vielfach verwundenes und verknäultes Molekül des Erbmaterials DNA -- bestimmt unsere genetische Identität. Und der Katalysator -- ein Enzym namens Nitrogenase -- ist die Spezialität der Knöllchenbakterien, die mit Hülsenfrüchtern in Symbiose leben und diese mit Dünger direkt aus der Luft versorgen.
Dies sind nur drei Beispiele aus den unendlich vielen kniffligen technischen Problemen, die lebende Zellen scheinbar mühelos bewältigen. Das zugrundeliegende Konstruktionsgeheimnis, das sich offenbar in 3 Milliarden Jahren Evolutionsgeschichte so bewährt hat, daß wir keine andere Lebensform kennen oder uns auch nur vorstellen können, ist das Baukastenprinzip. Die Nanotechnologie der Natur verwendet Kettenmoleküle, die aus einer geringen Zahl einheitlich kleiner Bausteine nach Maß zusammengesetzt werden können. Die gesamte Datenverarbeitung der Erbinformation kommt mit dem vier-Buchstaben-System aus, und die meisten Funktionen der lebenden Zelle werden von Proteinen ausgeführt, die ausschließlich oder hauptsächlich aus einem Satz von 20 Aminosäuren aufgebaut sind. Wir wollen diese "natürlichen Nanomaschinen" einmal näher betrachten und sehen, inwieweit sie bei der Entwicklung neuer Technologien als Vorbild dienen oder zumindest Anregungen und Ideen liefern können.
Moleküle: Ohne sie gäbe es kein Leben
Atome, die "Unteilbaren" werden allgemein als die Grundbausteine der Materie betrachtet. Zwar kann man sie unter extremen Bedingungen -- etwa in einem Kernreaktor oder Teilchenbeschleuniger -- zerlegen oder miteinander verschmelzen, doch im Hausgebrauch sind sie tatsächlich unteilbar. (Allenfalls kann man ihnen in einer chemischen Reaktion einige ihrer Elektronen entreißen, doch dadurch ändert sich ihre Masse nicht nennenswert.) Die physikalischen Eigenschaften der Atome bestimmen, ob und wie sie sich zu Molekülen zusammenschließen können. Bildung, Eigenschaften und Umwandlung von Molekülen zu beschreiben ist Aufgabe der Chemie -- ohne Atome keine Chemie.
Moleküle ihrerseits können nur zwei oder aber viele tausend Atome enthalten. Im letzteren Fall spricht man von Makromolekülen, auch wenn diese immer noch so klein sind, daß man sie im Lichtmikroskop nicht sehen kann. Im Gegensatz zu den eintönigen, aus endlos vielen gleichen Einheiten aufgebauten Makromolekülen der Kunststoffe (Polyethylen, Polyvinylchlorid, etc.), den sogenannten Homopolymeren, enthalten Heteropolymere verschiedene Bauelemente. Sie können in der Abfolge ihrer Bausteine Information speichern, und sie können eine Funktion erfüllen. Diese beiden Eigenschaften qualifizieren sie als Bausteine des Lebens -- ohne Moleküle kein Leben.
Wie klein sind denn nun Atome und Moleküle? Atome lassen sich kaum ausmessen, da sich ihre Elektronenwolke theoretisch beliebig weit in den Raum erstreckt. Nimmt man jedoch in einem Molekül aus zwei gleichen Atomen den halben Abstand der Atomkerne als Maßstab für den Radius, so sind alle Atome kleiner als ein Nanometer. Nach dieser Definition beträgt zum Beispiel der Durchmesser eines Wasserstoffatoms 0.06 nm, der des 32 mal so schweren Schwefelatoms 0.20 nm. Kleine Moleküle können wenige Nanometer messen, Makromoleküle können im ausgestreckten Zustand Mikrometer lang werden, im verknäuelten Zustand beträgt ihr Durchmesser typischerweise 10 bis 100 Nanometer (Abb.1).
In diesem Größenbereich können die Makromoleküle der lebenden Zelle Information speichern, weiterreichen und in Funktion umsetzen. Die Desoxyribonukleinsäure (DNA), vermutlich das prominenteste Molekül unserer Zeit, ist für die Information zuständig, die Proteine führen die Funktion aus. Ribonukleinsäure (RNA) kann beides und gilt deshalb vielen Wissenschaftlern als aussichtsreicher Kandidat für die Rolle des Urmoleküls, das vor der Entwicklung der komplizierten DNA-RNA-Protein-Maschinerie die Evolution des Lebens überhaupt ermöglichte.
Diese Moleküle agieren in der Regel als selbständige Maschinen in dem nanotechnologischen Großbetrieb der lebenden Zelle -- einige Beispiele hierfür werden in Teil II näher erläutert. Im Gegensatz dazu haben wir Menschen in der Vergangenheit Moleküle stets nur in großer Zahl verwendet. Eine wäg- und sichtbare Menge eines in Trockensubstanz vorliegenden mittelgroßen Proteins, z.B. 1 Milligramm des Enzyms Uricase, das zur Bestimmung der Harnsäurekonzentration im Blut eingesetzt wird, enthält etwa 6 Billiarden Moleküle, die in der Regel, wenn wir das Protein in einem diagnostischen Test einsetzen, alle dasselbe tun.
Um Maschinen im Nanometermaßstab konstruieren zu können, müssen wir Makromoleküle aufbauen, die ähnlich effizient sind wie die biologischen, und wir müssen sie für voll nehmen, d.h. wir müssen lernen, einzelnen Molekülen eine Aufgabe zuzuteilen, und deren Erfüllung abzufragen. Von den ersten Vorstößen in dieser Richtung handelt Teil III dieses Buches.
Doch mit der Zusammenfügung der Atome zu Makromolekülen allein erhalten wir noch keine Nanomaschinen. Deren Stärke liegt nämlich (unter anderem) in den schwachen Wechselwirkungen.
Wechselwirkungen: Die Schwächsten setzen sich durch
Mit dem klassischen Repertoire der organischen Chemie, die sich damit beschäftigt, Bindungen zwischen Atomen (hauptsächlich Kohlenstoff, aber auch Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und andere) so zu bilden und zu brechen, daß sich neuartige oder interessante Moleküle bilden, könnte man noch keine lebende Zelle nachbauen. So wichtig diese chemischen (kovalenten) Bindungen für die Synthese der Makromoleküle auch sind, bleiben sie doch für viele essentielle Vorgänge im Alltagsleben der Zelle zu starr und unflexibel. Eine stabile kovalente Bindung zu brechen erfordert oft die Verwendung eines Katalysators, eines großen Überschusses eines Reaktionspartners, oder -- im Labor -- hohe Temperaturen und spezielle nichtwäßrige Lösungsmittel.
Die Natur behilft sich mit der Nutzung einer Vielfalt sogenannter schwacher Wechselwirkungen (Abb. 2). Dazu zählen hauptsächlich
-- die Wasserstoffbrückenbindung (der wir unter anderem auch den ungewöhnlich hohen Siedepunkt des Wassers, und damit eine weitere Voraussetzung für die Entstehung des Lebens auf der Erde verdanken),
-- die elektrostatische Anziehung zwischen gegensätzlich geladenen Molekülteilen (Salzbrücken),
-- die van-der-Waals Anziehung zwischen der negativ geladenen Elektronenwolke eines Atoms und dem positiven Kern eines anderen, sowie
-- die Zusammenballungstendenz fettartiger, wassermeidender Molekülteile, die sogenannte hydrophobe Wechselwirkung (siehe Teil II, Kap. 2).
Wasserstoffbrücken halten zum Beispiel die Doppelhelix der DNA zusammen, und die lokalen Helix- und Faltblatt- Unterstrukturen der Proteine. Salzbrücken dienen oft der Bindung geladener Substrate an ein Enzym. Van-der-Waals-Wechselwirkungen können aufgrund ihrer kurzen Reichweite und geringen Stärke nur dort wirken, wo Molekülteile in komplementärer Paßform "einrasten". Die hydrophobe Wechselwirkung schließlich hält die Membranen aus Lipid-Doppelschichten zusammen, welche jede lebende Zelle von der Außenwelt abgrenzen, sowie in vielen Zellen auch Unterabteilungen ("Organellen") definieren. Sie ist auch die wesentliche treibende Kraft, die Proteine bei physiologischer Temperatur in dem kompakten, zu komplizierten Überstrukturen gefalteten Zustand hält, den diese zur Ausübung ihrer jeweiligen Funktion benötigen.
Alle diese Bindungen können durch Variation der Bedingungen leicht geöffnet und wieder geschlossen werden, was oft eine Voraussetzung für die Funktion der biologischen Makromoleküle ist. Damit zum Beispiel die DNA "gelesen", also zu RNA oder neuer DNA umgeschrieben werden kann, muß die Doppelhelix-Struktur an der Stelle, die gerade gelesen wird, aufgelöst werden. Damit das Sauerstoff-Speicherprotein des Muskels, Myoglobin, Sauerstoff aufnehmen oder abgeben kann, muß es seine Struktur lokal umordnen, um einen Kanal zu öffnen, der die Bindungsstelle mit der Außenwelt verbindet. Doch nicht nur für diese schnellen, lokalen Umordnungsprozesse sind die schwachen Wechselwirkungen lebensnotwendig. Sie ermöglichen außerdem die Zusammenlagerung makromolekularer Komponenten zu hochkomplizierten Systemen ohne Unterstützung durch andere Moleküle, die nicht Bestandteil des aufzubauenden Systems sind, die Selbstorganisation.
Selbstorganisation: Gemeinsam sind wir stark
Die Fabrik, in der das Darmbakterium Escherichia coli seine Proteine herstellt, das bakterielle Ribosom, besteht aus einer großen und einer kleinen Untereinheit, die insgesamt drei RNA-Moleküle und 52 verschiedenen Proteine enthalten. Obwohl Dutzende von Arbeitsgruppen in aller Welt seit mehr als zwei Jahrzehnten versuchen, den genauen Aufbau und die Funktionsweise des Ribosoms zu entschlüsseln, ist dies bis heute noch nicht vollständig gelungen Nimmt man es auseinander und reinigt die einzelnen Komponenten, so hat man am Ende 55 Töpfchen mit je einer Sorte Moleküle in wäßriger Lösung. Schüttet man nun alle Töpfchen, die mit einem S für "small subunit", die kleinere Untereinheit des Ribosoms, markiert sind, wieder zusammen, so bildet sich die funktionsfähige kleine Untereinheit wie von selbst. Bei der großen Untereinheit muß man in zwei Schritten vorgehen, d.h. erst die RNA mit einer bestimmten Teilgruppe der Proteine mischen, und dann die übrigen Proteine zufügen, um die Untereinheit wiederherzustellen. Gibt man schließlich die beiden Untereinheiten zusammen, so erhält man vollständig funktionsfähige Ribosomen. Und das ausschließlich durch vier Mischvorgänge, ohne irgendeine Stütze, oder ein Hilfsmittel, das die Bildung bestimmter Strukturen oder Wechselwirkungen begünstigt hätte.
Dieses spektakuläre, aber keineswegs einzigartige Beispiel zeigt ein wichtiges Prinzip der Nanotechnologie des Lebens auf. Die Maschinenteile sind so konstruiert, daß sie von selbst funktionsfähige Maschinen bilden. Es bedarf keines Baumeisters, keines Plans, keines Gerüsts -- die Strukturen tragen ihre Bestimmung schon in sich. Ähnlich lassen sich komplette Viren, etwa Tabakmosaikvirus (TMV; Abb. 3), oder Mikrotubuli, die röhrenförmigen Fasern des Zellskeletts, rekonstituieren.
Ein Beispiel, wie sich Forscher das Prinzip der Selbstorganisation erfolgreich zu eigen gemacht haben, um einen künstlichen Ionenkanal zu konstruieren, ist in Kapitel III.1. beschrieben. Doch, obwohl die Rekonstitution natürlicher Systeme, die sich wie das Ribosom von selbst zusammenfügen ("Assembly-Systeme") bereits vor Jahrzehnten im Reagensglas nachvollzogen werden konnte (TMV: 1972, kleine ribosomale Untereinheit: 1968, große Untereinheit: 1974), ist die Nutzung dieses Phänomens für synthetische Systeme nur selten versucht worden, und die Wissenschaft der schwachen Wechselwirkungen, die supramolekulare Chemie, steckt noch in den Kinderschuhen (Kap. III.1.).
Nachdem es so einfach war, die Maschinerie der Zelle zusammenzubauen, oder, ihr zuzuschauen, wie sie sich selbst zusammenbaut, wollen wir einmal sehen, was diese Wunderdinger denn eigentlich machen.
Katalyse: Chemische Reaktionen, schnell und exakt
Proteine können der Strukturbildung oder dem Transport kleiner Moleküle dienen, doch die allermeisten von ihnen beschleunigen (katalysieren) eine chemische Reaktion. In Extremfällen können sie Reaktionen, die in Abwesenheit eines Katalysators Millionen Jahre benötigen würden, in Bruchteilen von Sekunden ablaufen lassen. Proteine mit einer katalytischen Funktion bezeichnet man als Enzyme. Nachdem jahrzehntelang das Dogma bestand, daß die Rolle der Biokatalysatoren ausschließlich von Proteinen wahrgenommen wird, entdeckte man in den achtziger Jahren auch Katalysatoren, die ausschließlich RNA enthalten, die sogenannten Ribozyme.
Warum braucht die Zelle Enzyme? Zunächst einmal, um die Produktionsprozesse in ihrer chemischen Fabrik zu steuern. Katalysatoren können definitionsgemäß nicht die Richtung einer Reaktion bestimmen -- sie beschleunigen lediglich die Einstellung des durch die Umgebungsbedingungen und die chemische Natur der Reaktionspartner definierte Gleichgewicht (Abb. 4). Doch auch mit diesem scheinbar bescheidenen Einfluß können sie enorm viel erreichen. Zum Beispiel, indem sie aus einer Reihe von verschiedenen Reaktionen, die eine Substanz eingehen könnte, nur eine katalysieren. Auf diese Weise kann ein spezifischer Katalysator -- und Enzyme sind die spezifischsten Katalysatoren, die wir kennen, -- das Produktspektrum einer gegebenen Reaktionsmischung völlig verändern.
Enzyme können auch Reaktionen miteinander koppeln. Auf diese Weise können Reaktionen, die energetisch ungünstig wären und deshalb nicht von alleine ablaufen würden, etwa die Synthesen der Makromoleküle, mit einer energieliefernden Reaktion, etwa der Spaltung einer energiereichen Verbindung, angetrieben werden.
Viele Enzyme übertreffen die entsprechenden technischen Katalysatoren in ihrer Leistungsfähigkeit um Größenordnungen. So gibt es bis heute keinen technischen Katalysator, der die Ammoniaksynthese bei Atmosphärendruck und gemäßigter Temperatur betreiben könnte, wie es die Nitrogenase der Knöllchenbakterien tut.
Manche Enzyme werden im Haushalt eingesetzt, etwa bei der Quarkbereitung, zur Fleckentfernung oder im Waschmittel. Im Kosmetikbereich werden proteinabbauende Enzyme (Proteinasen) eingesetzt, und die kalt gelegte Dauerwelle kommt mit Hilfe eines Harnstoff abbauenden Enzyms (Urease) zustande.
Manche Enzyme haben in den Forschungslabors ihre eigenen Anwendungsmöglichkeiten geschaffen, oft in Verfahren, die ohne sie überhaupt nicht denkbar werden. Die prominentesten Beispiele sind die Restriktionsendonukleasen, von Bakterien als Abwehrwaffe gegen Viren entwickelt, und im genetischen Labor für die Fragmentierung von Nukleinsäuren unentbehrlich, sowie die DNA-Polymerase thermophiler Bakterien, welche die Polymerase-Kettenreaktion (ja, genau -- die aus Jurassic Park), d.h. die exponentielle Vervielfältigung von DNA ausgehend von nur wenigen Molekülen, ermöglicht hat.
Und manche Enzyme werden bereits industriell eingesetzt, bisher hauptsächlich bei einfachen Reaktionen wie dem Abbau von Stärke zu Rohrzucker (Jahresumsatz 20 Millionen Tonnen; von dem dazu benötigten Enzym Amyloglucosidase werden jährlich 15000 Tonnen hergestellt!) oder der Vergärung von Kohlenhydraten zu Alkohol, ein Verfahren das in Brasilien forciert wird, um die Abhängigkeit des Landes von Erdölimporten zu verringern.
Enzymatische Prozesse gewinnen aber auch bei der Herstellung von Pharmaka und in der Lebensmittelverarbeitung zunehmend an Bedeutung.
Obwohl es Millionen verschiedener Enzyme in der Natur gibt, deren Nutzpotential noch lange nicht ausgeschöpft ist, wäre es für viel technische Anwendungen erstrebenswert, ähnlich spezifische Katalysatoren nach Maß herstellen zu können. Zum Beispiel um die Probleme mit der begrenzten Stabilität und Haltbarkeit von Proteinen zu umgehen. Verschiedene Ansätze zur Herstellung künstlicher Enzyme werden in Teil III, Kapitel 1 vorgestellt.
Doch um ihren Stoffwechsel nicht ins Chaos zu führen, muß eine Zelle nicht nur die chemischen Reaktionen steuern, sie muß sie auch räumlich organisieren.
Kompartimentierung: Ordnung ist das halbe Leben
Den ersten Schritt zur räumlichen Eingrenzung des Geflechts aus chemischen Reaktionen, das wir als Leben bezeichnen, stellt natürlich die Entwicklung der Zelle selbst dar. Mindestens eine Doppelschichtmembran, in vielen Fällen auch eine Zellwand, sowie weitere Schichten und Zwischenräume trennen die Zelle vom Rest der Welt und verhindern, daß wertvolle Stoffe wegdiffundieren, oder Schadstoffe aus der Umgebung unkontrolliert eindringen können.
Doch auch innerhalb der Zellen herrscht Ordnung. Wir sogenannten höheren Lebewesen zählen, vom Zelltyp her gesehen, zu den Eukaryonten. Das heißt, daß jede unserer Zellen einen echten Zellkern hat. Weitere Unterabteilungen (Organellen) der Eukaryontenzelle hören auf schwierige bis unaussprechliche Namen wie etwa Mitochondrion, Endoplasmatisches Retikulum, Golgi-Apparat etc. (Abb. 5).
Wichtig ist hier jedoch nur, daß die Zelle offenbar für verschiedene Funktionen abgegrenzte Bereiche aufweist, so wie wir unsere Häuser in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, Kinderzimmer, etc. unterteilen. Das erfordert gleichzeitig weitere Arten von Nanomaschinen und -strukturen. Die Abgrenzungen zwischen den Abteilungen müssen aufgebaut werden -- nach dem, was wir über Selbstorganisation erfahren haben, liegt die Vermutung nahe, daß dieses Prinzip auch hier am Werk ist, sodaß wir keine Baukräne oder Gerüste für die Errichtung der Zwischenwände brauchen. Sind die Wände einmal da, so brauchen wir außerdem Transportwege, um den Verkehr zwischen den Zimmern zu ermöglichen. Einfache Türen würden im Fall der Zelle wenig nützen, da es ja darum geht, den Verkehr zwischen den Räumen zu kontrollieren und zu steuern. Eine Art regulierbares Ventil mag genügen, wenn Dinge aus dem volleren Raum in den leereren gelangen sollen. Doch oft besteht das Problem darin, daß Verbindungen gegen den natürlichen Trend zur Gleichverteilung transportiert werden müssen. In diesem Fall bietet sich das Prinzip der Kopplung mit einem energieverbrauchenden Prozess an, das wir bei den Enzymen schon kennengelernt haben.
Innerhalb der einzelnen Zimmer, und auch innerhalb der weitaus weniger "aufgeräumten" Bakterienzelle hatte man lange ein chaotisches Umherschwimmen aller vorhandenen Stoffe vermutet. Es zeichnet sich jedoch ab, daß auch die in Lösung befindlichen Enzyme sich räumlich organisieren. Die Nanomaschinen sind sozusagen zu einer Fertigungsstraße aufgereiht, in der das Produkt von einem Schritt zum nächsten weitergereicht werden kann. So finden sich zum Beispiel in der Nähe der Ribosomen, welche die Proteine synthetisieren, oft auch die molekularen Chaperone, die deren Faltung überwachen (Kap. II.2.).
Erst vor kurzem (1994) gelang die Entwicklung einer Methode, Biomakromoleküle oder ähnlich komplexe Systeme, zumindest in zwei Dimensionen, mit Nanometer-Präzision genau anzuordnen. Diese Technik, über die im Teil III, Kapitel 2 Näheres zu erfahren ist, erlaubt es auch, ein biotechnologisches Fließband zu konstruieren, wo das Substrat jeweils ohne diffusionsbedingte Zeit- und Stoff-Verlust von einem bearbeitenden Enzym zum nächsten weitergereicht wird.
Schließlich wollen wir, obwohl wir uns mit der Betrachtung ganzer Zellen schon verdächtig weit in den Mikrometermaßstab hinaufgewagt haben, noch einen Blick aufs große Ganze werfen.
Evolution: Vom Molekül zum Organismus
Vom Urknall bis zur Entstehung der Pflanzen und Tiere läßt sich eine Linie der zunehmenden Organisation immer größerer Zusammenhänge ziehen -- subatomare Partikel zu Atomen, Atome zu kleinen Molekülen, diese zu Makromolekülen, Makromolekülen zu Zellen und Zellen zu Vielzellern. Dabei wird die Größenskala von Femtometer (ein billionstel oder 10--12 Meter) bis zu etwa 30 m durchlaufen, wenn wir etwa an Blauwale oder Dinosaurier denken. Die Evolutionstheorie stellt eine schlüssige Verbindung für den größten Teil des Weges her, mindestens von dem ersten Makromolekül, das seine eigene Vervielfältigung bewerkstelligen konnte, -- möglicherweise eine einfache Variante der heutigen RNA -- bis zu den heutigen Lebewesen, also vom Nanometer- bis zum Meter-Maßstab, und von der Urzeit des Lebens auf der Erde (drei Milliarden Jahre vor unserer Zeit) bis heute.
Manche Forscher glauben sogar, daß das Wirken der Evolutionsprinzipien Mutation und Selektion zeitlich noch weiter zurück und räumlich in noch kleinere Dimensionen reicht. Demzufolge wären Baufehler in den sonst regelmäßigen Kristallgittern gewisser Tonmineralien die erste Form von "Erbinformation" gewesen. Demnach hätte sozusagen eine Vor-Evolution im Reich der Atome und anorganischen Festkörper stattgefunden, auf der die später entstandenen Makromoleküle aufbauen konnten. Auch die verblüffenden Fähigkeiten der Zellen und Proteine bei der Steuerung der Abscheidung von Mineralien in kristalliner oder amorpher Form (Kap. II.1.) solche Überlegungen plausibel erscheinen.
Der letzte Schritt, von der Zelle zum komplizierten Organismus, gehört eigentlich nicht mehr zu unserem Nano-Thema. Es sei jedoch kurz darauf hingewiesen, daß bei der Kommunikation zwischen Zellen, die ja im Vielzeller nötig ist und im großen Umfang stattfindet, ebenfalls ein Bereich der "natürlichen Nanotechnik" ist, von dem sich die menschlichen Informationswissenschaftler und Computertechniker noch einiges abschauen könnten.
Die Rundruf-Funktion ("Großhirn an alle") wird oft durch Hormone und die dazugehörigen Rezeptoren ausgeübt. Selbstorganisation ist hier wieder im Spiel, wenn sich ein Rezeptorkomplex in die Membran einlagert; Sulbstraterkennung und schwache Wechselwirkungen sind vonnöten, wenn das Hormon an den Rezeptor bindet, und dieser dann eine Folgereaktion auslöst.
Für ortsgerichtete Informationsübertragung hat unser Körper sein eigenes Telephon-Netz: das Nervensystem. Zusätzlich zu den bereits diskutierten Phänomenen spielen hier auch elektrische Ströme und Spannungen eine wichtige Rolle. Und, an der am meisten studierten und am besten verstandenen Stelle des Nervensystems, der Netzhaut des Auges, kommt Licht als zusätzliche Signalform hinzu. Signalumwandlung zwischen den Energieformen Licht, Elektrizität, und chemischer Energie auf der Größenskala der Zellrezeptoren ist sicherlich eines der Ziele für die Nanotechnologie.
Technik: Zurück zum Molekül
In einem gewissen Sinne gehen wir Menschen den Weg der Naturgeschichte vom Femtometer zum Meter jetzt wieder zurück. Die ersten Werkzeuge, die Menschen anfertigten und verwendeten, entsprachen in ihren Dimensionen unseren natürlichen Werkzeugen, den Händen und Armen. Obwohl frühe Kulturen bei der Errichtung großer Strukturen Erstaunliches leisteten, und, ohne es zu wissen, bereits Mikroorganismen zum Brotbacken und Bierbrauen einsetzten, gibt es keine Belege für die Untersuchung oder Manipulation des unsichtbar Kleinen. Atome waren zwar seit Demokrit ein philosophisches Postulat, sind aber über diesen Zustand mehr als 2000 Jahre lang nicht hinausgekommen.
Erst im 17. Jahrhundert verschaffte das Lichtmikroskop (1590 in Holland erfunden) zumindest Einblick in die Mikrowelt. Der Niederländer Antoni van Leeuwenhoek, seines Zeichens Krämer und ein krasser Außenseiter des Wissenschaftsbetriebs seiner Zeit, war der erste, der ein genügend stark vergrößerndes Mikroskop entwickelte, um die Welt der Mikroben zu entdecken (1675).
Die Fertigung kleiner Strukturen blieb bis ins 19. Jahrhundert hinein ein Privileg der Uhrmacher -- und die kamen meist mit einer Lupe aus, d.h. sie bewegten sich eher im Bereich der Zehntel Millimeter als in dem der Mikrometer. Die im 19. Jahrhundert zunächst zur exakten Wissenschaft und dann zur Leitindustrie heranwachsenden Chemie hatte zunächst einen ausgeprägten Drang zum Großen, nicht aber zum Kleinen. Erst die Miniaturisierung der Elektronikbausteine in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts hat das Interesse an der Fertigung im Mikrometermaßstab geweckt.
Einblick in die Nanowelt gewähren uns seit Mitte diesen Jahrhunderts Techniken wie die Elektronenmikroskopie, Röntgenkristallographie, Neutronenbeugung, und Kernmagnetische Resonanzspektroskopie. Die Chemie hat in den vergangenen 200 Jahren gelernt, mit Molekülen umzugehen, ihren Aufbau zu beschreiben und neuartige Moleküle herzustellen. Dabei wurden die Moleküle jedoch immer in makroskopischen Mengen gehandhabt, und der Größe der analysierbaren oder synthetisierbaren Systeme waren stets Grenzen gesetzt. Zudem war die Wissenschaft von den Riesenmolekülen, die makromolekulare Chemie, lange Zeit ein Stiefkind der Chemie, das weder die Gleichstellung mit den klassischen Disziplinen (anorganische, organische und physikalische Chemie), noch eine Verselbständigung nach Art der Biochemie jemals erreichen konnte.
Die Herstellung von Nanowerkzeugen lernen wir erst jetzt, in diesem letzten Fünftel unseres Jahrhunderts. Erst jetzt nähern sich die Disziplinen der Biochemie, Chemie, Physik und Biologie, die sich mit natürlichen Nanosystemen befassen oder die Erzeugung künstlicher Nanosysteme anstreben, einander an. Erst jetzt nutzen Chemiker die Kraft der schwachen Wechselwirkungen und das Prinzip der Selbstorganisation, um synthetische Moleküle ähnlich leistungsstark zu machen wie biologische Systeme. Erst jetzt sind Materialbearbeitungsmethoden so weit miniaturisiert worden, daß man nanometergroße Strukturen aus einem Halbleitermaterial herausätzen und somit elektronische Schaltelemente ebenso wie mechanische Maschinenteile in diesem winzigen Format herstellen kann.
Vorstöße in eine neue Dimension haben das Potential, die Welt zu verändern. Ebenso wie die Entdeckung der Welt der Mikroben durch die Entwicklung des Mikroskops oder der Siegeszug der Computer nach der Erfindung des Mikrochip, können die Technologien, die uns aus der Eroberung der Nanowelt zuwachsen werden, nicht nur die Welt der Wissenschaft, sondern auch unser Alltagsleben umkrempeln. Von einigen Propheten der Nanotechnologie und von ihren Prophezeiungen wird in Teil IV die Rede sein. Von der Medizin bis zur Raumfahrt, von der Datenverarbeitung bis zum Umweltschutz reichen die prognostizierten Anwendungen der Nanomaschinen. Wir werden sehen, daß die Nanowelt auch sehr viel mit unserer Makrowelt zu tun hat.
Order Travels to the Nanoworld from:
last update:
12.01.2005