Funde aus der prähistorischen Zeit,
insbesondere aus der Hallstattzeit (vor Chr. Geb.) beweisen die
Anwesenheit von Menschen in unserem Raum. Auch die Römer hatten ihre
Spuren hinterlassen.
Nach der Besiedelung durch die Bajuwaren (im
6. Jh.) war Mattighofen einer der fünf herzoglichen Höfe. 757 entstand
hier eine königliche Pfalz. 1007 wurde der Mattigau an das Bistum Bamberg
geschenkt und von dort an durch Franken und Schwaben erneut
besiedelt.
1436 errichtete Ritter Hans Kuchler hier ein
Kollegialstift. Zur Zeit der Reformation war Mattighofen im Besitz der
protestantischen Grafen von Ortenburg, nach 1600 gehörte es den bayrischen
Herzögen, die durch Pfleger das Gebiet verwalten ließen und das Marktrecht
aus dem 15. Jh. mehrmals bestätigen. 1685 wurde in Mattighofen eine
Propstei gegründet.
Durch den Frieden von Teschen im Jahre 1779
kam das Innviertel zu Österreich. Damit war die 1200 Jahre dauernde
Zugehörigkeit zu Bayern beendet.
Auf Grund seiner Zentralfunktion und
wirtschaftlichen Bedeutung wurde Mattighofen 1986 von der
oberösterreichischen Landesregierung zur Stadt erhoben.
Quelle: Auszug aus Stadtplan Mattighofen
Entstehung des Ortsnamens:
 |
Landeshauptmann Ratzenböck (li), Bürgermeister Bachleitner (mi) und Landeshauptmann Stv. Grünner (re) mit der Stadterhebungsukunde 1986 |
Von allen Orten des Bezirks hat Mattighofen
den ältesten Namen. Die Stadt ist nach der Mattig benannt, dem einzigen
Gewässer, das außer den wesentlich größeren Grenzflüssen Inn und Salzach
seinen vordeutschen Namen behalten hat. Dies weist auf eine ununterbrochen
weiter bestehende Tradition von Bewohnern hin. Die Stadt auf dem
auslaufenden Sporn eines lang gestreckten, schmalen Hügels zwischen den
Flussebenen der Mattig und des Schwemmbaches ist nicht nur eine der
ältesten Siedlungen, sondern auch schon in früher Zeit der Hauptort und
das Verwaltungszentrum eines weiten Gebietes gewesen, nämlich des
Mattiggaues. "Gau" bedeutet natürlich in erster Linie ein Territorium,
mitunter aber auch den Hauptort samt seinem zugehörigen Bereich. Die
urkundlichen Belege für Mattighofen reichen sehr weit zurück, wobei im
Einzelfall oft nicht mit Sicherheit zu entscheiden ist, ob diesmal der
Gau, ein andermal der Ort gemeint ist. Jedenfalls hieß auch der Ort
ursprünglich "Mattiggau". Die zahlreich überlieferten urkundlichen
Nennungen, deren älteste bis vor das Jahr 748 zurückreichen, weichen in
der Schreibung geringfügig voneinander ab. Die häufigste Schreibung lautet
"Matahgouue" (zu sprechen "Matachgaue"). Schon seit dem Jahr 860 taucht in
den Urkunden immer öfter der Name "Matahhoua" (Matahova) auf (zu sprechen
"Matachhofa"). Dieser Name hat sich schließlich durchgesetzt: die Stadt
heißt heute Mattighofen.
So entwickelte sich der Ortsname von
Mattighofen: vor 788 Matagao, 800 Matichau, 802 in loco, qui dicitur
Matahgauue, 885 Matachov, 890 Matachova villa regia, 1007 Matughof, ca.
1070 Maticha, 1150 Mathchoven, 1164 Matenchoven, 1287 Matechoven, 1486
Matikhoven, 1532 Mätigkhoven
Quelle: Heimatbuch der Marktgemeinde Mattighofen von Franz
Sonntag
Die Bierbrauerei in
Mattighofen:
Über vier Jahrhunderte wurde in Mattighofen
Bier gebraut. Bier, das weitum bekannt war und gerne getrunken wurde. Die
Überlieferung kennt durch Briefaufdrucke und Reklame als Gründungsjahr
einer Brauerei in Mattighofen das Jahr 1550. Im Verlaufe der Jahrhunderte
haben die Braumeister ihr Rezept zur Herstellung des Gerstensaftes nicht
verändert. Nur für die Weißbierliebhaber war eine andere Zubereitung
angewendet worden. Der Hauptrohstoff der Biererzeugung, die Gerste, kam
größtenteils aus dem Innviertel. Der Jahresbedarf der Brauerei Mattighofen
betrug um 1950 zirka 70 Waggons. Über 25.000 Hektoliter Bier wurden daraus
erzeugt. Zur Zeit des 400-Jahr-Jubiläums im Jahre 1950 gab es neben
schönen Pferdegespannen bereits einen gutausgestatteten Kraftwagenpark.
Damals wurden rund 180 Wirte und andere Kunden im oberen Innviertel und im
angrenzenden Bundesland Salzburg beliefert. Im Februar 1975 kam die für
viele unverständliche Fusionierung mit der Österreichischen Brau AG. Zu
dieser Zeit lag die Jahresproduktion mit 70 Arbeitern und Angestellten bei
45.000 bis 50.000 Hektoliter Bier. Mit 31. Oktober 1975 stellte die
Österreichische Brau AG die gesamte Produktion in Mattighofen ein, die
Brauerei wurde vollständig geräumt und als Niederlassung zur Belieferung
von Zipfer Bier eingerichtet. Als symbolischer Schlussakt der über
400jährigen Brautradition kann wohl die Sprengung des 36 Meter hohen
Schlotes am 7. Dezember 1982 angesehen werden.
Quelle: Heimatbuch der Marktgemeinde Mattighofen von Franz
Sonntag
Die Lederfabrik Vogl:
Einst die größte Fabrik der Monarchie und
zweitgrößte Europas.
Im Jahre 1830 gründete der 1802 in Lam im
Bayrischen Wald geborene Bauernsohn Wolfgang Vogl den heutigen Betrieb,
indem er die Witwe seines Meisters der schon damals bestehenden Lirk´schen
Gerberei in der Moosstraße heiratete. Wolfgang Vogl fang guten Absatz
seiner Erzeugnisse und soll dabei 1859 bis in die Lombardei gekommen sein.
Nach dessen Tod im Jahre 1869 übernahm sein Sohn Friedrich Vogl den
Betrieb mit acht bis zehn Gesellen. Dieser baute das Werk derart aus, dass
darin an die 150 Arbeiter beschäftigt werden konnten. 1900 übergab er die
Fabrik seinen beiden Söhnen Fritz und Ludwig. Nach der Absatzkrise 1907,
konnte im Jahre 1909 mit einer regen Bautätigkeit begonnen werden. 1911
folgte ein neues Kessel- und Maschinenhaus mit einem 62 Meter hohen
Schornstein. 1916 konnte der erste Zug die Werksgeleise vom Bahnhof
Mattighofen in das Gelände der Lederfabrik befahren. Bis Kriegsende 1918,
wurden viele weitere Werkstätten, u.a. die Schuhfabrik, erbaut. Nach dem
2. Weltkrieg wurde die Bautätigkeit fortgesetzt. Anfang der 60er Jahre
mussten erhebliche Fabrikationsumstellungen getroffen werden. Zu Beginn
der 70er Jahre geriet die Firma Vogl immer mehr in finanzielle
Schwierigkeiten und wurde 1973 schließlich liquidiert. Der
Beschäftigungsstand von 470 konnte längst nicht mehr gehalten werden. 1974
wurde von Dipl. Ing. Wolfgang Vogl, Dipl.-Kfm. Werner Vogl und Ing. Erich
Schmid eine neue Gesellschaft gegründet, die vorerst Räume der alten
Fabrik mietete und mit der Produktion von hochwertigem Schuh- und
Bekleidungsleder begann. Ende der 70er Jahre wurden die benötigten Räume
käuflich erworben und Maschinenpark laufend erneuert. Gegenwärtig werden
pro Jahr 500.000 m² Leder erzeugt, wovon 85 % in alle Teile der Welt
exportiert werden.
Quelle: Heimatbuch der Marktgemeinde Mattighofen von Franz
Sonntag
KTM Mattighofen:
1934 Gründung einer Schlosserwerkstatt durch
Hans Trunkenpolz.1937 - 1950 Die Firma Trunkenpolz wird laufend ausgebaut
und entwickelt sich zu einer der größten Reparaturwerkstätten
Oberösterreichs.
Der offizielle Name der Firma lautet von 1950 ab
Kraftfahrzeuge Trunkenpolz Mattighofen. 1953 werden mit 20 Personen bis zu
6 Stück KTM R 100 erzeugt. 1955 wird der Salzburger Kaufmann Ernst
Kronreif Gesellschafter der Firma. Der Firmenname lautet nun Kronreif
& Trunkenpolz Mattighofen. Täglich werden 20 Motorräder erzeugt. 1957
gewinnt KTM erstmals die österreichische Motocross - Staatsmeisterschaft
bis 125ccm. 1962 stirbt unerwartet Hans Trunkenpolz. Mit 180 Mitarbeitern
wird ein Jahresumsatz von 48 Mill. Schilling erreicht. 1964 wird eine 800
m² große Lagerhalle erbaut. 1967 wird eine weitere 3000 m² große Shedhalle
erbaut. Der Umsatz steigt 1972 bei 400 Beschäftigten auf über 325 Mill.
Schilling. Nächstes Jahr wird eine weitere Shedhalle für die
Konstruktions- und Entwicklungsabteilung errichtet. 1976 steigt der Umsatz
auf 500 Mill. Schilling bei 520 Mitarbeiter. 1977 wird auf einem 30.000 m²
großen Areal (ehem. Lohmühle Fa. Vogl) ein Zweigwerk errichtet. 1978 wird
die Tochterfirma „KTM America Inc.“ in Lorain, Ohio, gegründet. Der
Exportanteil lag dieses Jahr bei 72 Prozent. 1983 lag der Umsatz bei 700
Mill. Schilling. 1988 wurde die Rollerproduktion eingestellt. 1991 Konkurs
der KTM Motorfahrzeugbau AG und Aufsplittung in eigenständige
Nachfolgefirmen für Motorräder, Kühler, Werkzeugbau und Fahrräder. Mit
neuer Führung, neuem Hard-Enduro-Konzept neuem Design für KTM-Motorräder
schließt das erste Geschäftsjahr erfolgreich ab. 1994 Umgründung der KTM
Sportmotorcycle GmbH in die KTM Sportmotorcycle AG. Mitarbeiterstand 212
Personen. 1996 Notierung an der Wiener Börse (Fliesshandel). Bis 1998
Übernahme von White Power Suspension (NL) und Husaberg AB (Schweden).
Gründung weiterer Vertriebstöchter in den europäischen Kernmärkten
Deutschland, Schweiz und England. Mitarbeiterstand September 1998 ca. 650
Personen, davon ca. 450 im Stammwerk Mattighofen. 1.September 1999:
Produktionsbeginn im neuen KTM Werk. Gründung der Vertriebstochter KTM
Espana S.L. KTM Sportmotorcycle AG zieht sich von der Börse zurück, der
Aktienrückkauf wird erfolgreich abgeschlossen.
Quelle: Heimatbuch der Marktgemeinde Mattighofen von Franz
Sonntag
Stadtwappen:
![]()
Über eine Wappenverleihung an Mattighofen
ist nichts bekannt. Möglicherweise ist das Wappen aus einem Siegelbild
übernommen worden. Für die aus Siegelbildern entstandenen Ortswappen ist
eine tatsächliche Verleihung nie erfolgt; ihre im alten Herkommen
begründete Gültigkeit ist ungeschrieben anerkannt worden, sodass für die
Berechtigung der Führung dieser Wappen von einem Gewohnheitsrecht
gesprochen werden kann. 1928 verzichtete die Marktgemeinde auf die
Ausstellung einer Urkunde bezüglich des Markt- und Wappenrechtes wegen der
zu hohen Kosten (Archiv-Akt Nr. 126).
Erster Nachweis des Marktwappens in einem
Siegel mit der Unterschrift "Sigil gemaines Marckhts Mattighofen" ,
Abdruck auf einem Akt vom 2. Juni 1781 (O.Ö. Landesarchiv, theresianische
Fassion). Ferner findet sich im Hauptstaatsarchiv in München eine
Martrikel der Stadt- und Marktwappen des Königreiches Bayern aus dem Jahre
1818, in der das Wappenrecht Mattighofen nachgewiesen wird. Auf einem
Stich von 1649 scheint das Marktwappen auf, das wahrscheinlich die älteste
Darstellung des Wappens sein dürfte.
Das Wappen: "In Blau eine silberne,
rechtsgekehrte, gesichtete Mondsichel, vorne begleitet von einem goldenem
sechsstrahligen Stern." Die farbige Wiedergabe des aus der 1. Hälfte des
17. Jahrhunderts stammenden Siegels in der Sammlung Felix J. Liposowskys
(1812) zeigt im Gegensatz dazu die Mondsichel in Gold.
Quelle: Heimatbuch der Marktgemeinde Mattighofen von Franz
Sonntag
Ansichten
Mattighofens:
 |
 |
|
Stadtplatz in der Nachkriegszeit |
Südl. Ortseinfahrt (von Munderfing) |
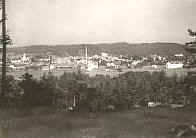 |
 |
|
Sicht auf Mattighofen (vom Siedelberg) |
Unterlochnerstraße mit Schöndorf |
Quelle: Fotoarchiv Stadtamt
Mattighofen


