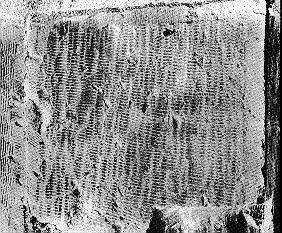 Stufe V: Stufe V:
Bis nach der Mitte des 12. Jahrhunderts beschränkten
sich die Werkzeugformen für die Oberflächengestaltung
auf die absprengende Wirkung der Werkzeugspitze
(Spitzeisen, Zweispitz/Spitzfläche) oder einer glatten
Schneide (Fläche, Meißel). Durch die enge
Aneinanderreihung einzelner Spitzen entsteht eine
gezahnte Schneide, welche die Vorteile beider
Werkzeugformen vereinigt. Allerdings besitzt die gezahnte
Schneide - zumindest beim technischen Stand
mittelalterlicher Werkzeugschmiede - nicht die robuste
Dauerhaftigkeit der Einzelwerkzeuge mit Spitze oder
Schneide. Sowohl Zahneisen als auch Zahnfläche dürften
ihren Ursprung im Gebiet der Weichgesteine haben.
Friederich vermutet als Ursprungsgebiet der gezahnten
Werkzeuge nordfranzösische Kalkstein- und
Kreidelandschaften, von wo aus unter anderem die
Anwendung der Zahnfläche zunächst nach Straßburg
(Ostteile) vermittelt wurde und sich dann über die
Kalksteingebiete Deutschlands weiter verbreitete. In
Gebieten mit Kristalingesteinen scheinen die gezahnten
Werkzeuge wegen der größeren Gesteinshärte zu fehlen.
Hier mußte man die Bearbeitung mit der Glattfläche
durchführen (man vergleiche dazu die Stufe IV nach Friederich).
Häufig wird die Zahnfläche im "Stich"
verwendet, was bei Kreide- und Kalksteinwerkstücken im
bruchfeuchten Zustand ein wesentlich ökonomischeres,
weil rasches Arbeiten ermöglicht, als dies bei der
Bearbeitung auf der "Bank" der Fall wäre.
Friederich wertet dies übrigens als einen weiteren
Hinweis auf die französiche Provenienz der Zahnfläche.
 Die Zahnfläche dient seit dem Ende des 12.
Jahrhunderts in erster Linie der raschen und gröberen
Bearbeitung des Werkstückes aus Weichgestein. Die
charakteristischen Werkzeugspuren verleihen dem
Quaderspiegel zusammen mit dem mittelbreiten Randschlag
wieder eine Textur und optisch wirksame Individualität,
welche sich essentiell von der weiter gepflegten
Glattflächung der Stufe IV
unterscheidet - insbesondere dort, wo man Weichgesteine
offensichtlich bewußt nicht mit dem neuen Werkzeug der
Zahnfläche bearbeitete. Die Blütezeit der Zahnflächung
als oberflächengestaltendes Werkzeug liegt im 13.
Jahrhundert und wird in verfeinerter Form und
Hiebführung als künstlerisches Gestaltungsmittel in Stufe VI noch bis nach dem 14.
Jahrhundert weiterverwendet. Die Zahnfläche dient seit dem Ende des 12.
Jahrhunderts in erster Linie der raschen und gröberen
Bearbeitung des Werkstückes aus Weichgestein. Die
charakteristischen Werkzeugspuren verleihen dem
Quaderspiegel zusammen mit dem mittelbreiten Randschlag
wieder eine Textur und optisch wirksame Individualität,
welche sich essentiell von der weiter gepflegten
Glattflächung der Stufe IV
unterscheidet - insbesondere dort, wo man Weichgesteine
offensichtlich bewußt nicht mit dem neuen Werkzeug der
Zahnfläche bearbeitete. Die Blütezeit der Zahnflächung
als oberflächengestaltendes Werkzeug liegt im 13.
Jahrhundert und wird in verfeinerter Form und
Hiebführung als künstlerisches Gestaltungsmittel in Stufe VI noch bis nach dem 14.
Jahrhundert weiterverwendet.
|