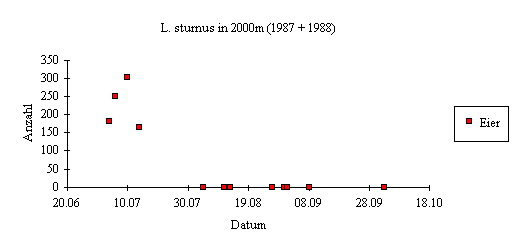8.5.1. Larinus sturnus an Cirsium spinosissimum
Larinus sturnus gehört zu den Massentieren auf dieser Wirtspflanze in den höheren Regionen des UG. KOCH (1992) bezeichnet ihn als "stenotop, bes. praticol - herbicol - floricol - phyllophag. Habitat: Bes. in frischen Gebieten: Wiesen, Waldlichtungen, Österreich: auch Ruderalstellen. Nische: oligophag auf Cirsium, Carduus, Arctium und Centaurea". Überall wo seine Nahrungspflanze Cirsium spinosissimum (Bild 32 KB) (Alpenkratzdistel) vorkommt, kann man während der Sommermonate auf Entwicklungsstadien dieses Curculioniden stoßen. Sowohl Larven als auch Imagines ernähren sich von dieser Kratzdistelart. Der Befall durch die Käfer schwankt aber von Standort zu Standort und auch von Jahr zu Jahr. ZWÖLFER (1960) weist einen 60%-igen Befall nach. Im UG wurden aber mehrfach auch Aufsammlungen an Dutzenden Horsten von Cirsium spinosissimum durchgeführt, auf denen jeder Blütenkopf befallen war.
Die Pflanze bietet dem Insekt ausreichend Nahrung, Lebensraum und Versteck. In den stachelbesetzten Blättern und Trieben finden die erwachsenen Käfer optimale Möglichkeiten, sich vor Freßfeinden zu verstecken.
Die Pflanze ist überall im Alpenraum verbreitet und steigt im UG bis 2600 m hoch. Besonders an beweideten Stellen, um Sennhütten und Weideflächen, aber auch auf schuttbedeckten Fluren ist die stickstoffanzeigende Distelart zu finden. Sie wurde im UG nicht unter 1800 m gefunden.
In der Literatur finden sich relativ wenige Angaben zur Biologie und Ökologie alpiner Populationen von Larinus sturnus. Daher werden die eigenen Beobachtungen hier beschreibend wiedergegeben. Die Paarung der Käfer findet im oberen Sproßbereich, auf den Blättern oder den Blütenköpfen statt. Die Tiere sind leicht zu beunruhigen, unterbrechen die Paarung bei Störung sofort und verkriechen sich. Die Grundfarbe der Käfer ist schwarz mit gelben Punkten. Anfang Juli beginnen die L. sturnus-Weibchen mit der Eiablage (Bild 11 KB). Diese werden an die jungen, noch saftigen Knospen der C. spinosissimum-Blütenköpfe gelegt.
Die Weibchen haben schlanke, gebogene Rüssel, deren Länge mit der Größe der Distelköpfe übereinstimmen, sodaß sie die noch geschlossenen Blütenköpfe der Wirtspflanze anbohren und eine Höhle für die Aufnahme eines Eies erzeugen können. Im Gegensatz zu diesen "Knospenstechern" stehen andere Larinus-Arten auf anderen Wirtspflanzen, die die Eier zwischen die Einzelblüten der bereits geöffneten Blütenköpfe schieben. Diese Merkmale weisen nach ZWÖLFER (1981) auf eine unterschiedliche Einnischung hin und kennzeichnen somit den Beginn einer Mikroevolution.
Einige Tage nach der Eiablage schlüpft die weiße Larve von Larinus sturnus und beginnt sich ins Innere des Blütenkopfes durchzufressen. Solcherlei befallene Knospen weisen eine typische häufig dunkle Eintiefung auf. Das erste von drei Larvenstadien bleibt in den äußeren Knospenschichten. Die Larve (L1) mißt etwa 0,5 cm. Das zweite (L2) und dritte Stadium (L3) frißt sich eine innen ausgekleidete Wohnhöhle am Grund der Blütenköpfe aus. Die Puppen sind gelblichweiß und beweglich. Sie liegen oft zu zweit bis zu fünft, untereinander fein säuberlich getrennt in ihren Wohnkammern in einem Blütenkopf. Die Tiere schlüpfen etwa Mitte August. Danach findet man die adulten Käfer einige Tage auf den Blütenköpfen. Bald verschwinden sie aber, überwintern als Imagines in einem Bodenversteck und erscheinen wieder Ende Juni auf den jungen Trieben der Wirtspflanzen.
Der Befall durch Larinus sturnus fällt dem Betrachter durch die dunkle bis schwarze Färbung des zerfressenen und zersetzten Blütenkopfgewebes auf. Selten findet man völlig intakte blühende Köpfe auf einer Pflanze. Am stärksten befallen waren C. spinosissimum-Blütenköpfe in Höhen um 2000 m. Es fiel auf, daß der stärkste Befall an einzelstehenden Horsten der Wirtspflanze zu beobachten war. Larinus sturnus geht vereinzelt auch auf andere Wirtspflanzen wie Cirsium heterophyllum (5 Nachweise) und Cirsium eriophorum (6 Nachweise). Der Befall schwankte im UG zwischen 20% (Velilltal 2000m; 23.08.88) und 100% (Paznauner Thaja 2000m; 23.08.88). Für die Bestimmung des Befalles wurden zufällig Blütenköpfe ausgesucht und an Ort und Stelle genau auseinandergenommen. Im Durchschnitt wurden an einer Stelle 14 Blütenköpfe untersucht.
ZWÖLFER (1974) unterscheidet zwischen alpinen und nicht-alpinen Populationen von Larinus sturnus, bezeichnet diese als "Ökotypen" und führt Unterscheidungsmerkmale an, die signifikant sind. Nach seinen persönlichen Mitteilungen im Juni 1988 ist eine Unterscheidung auf Unterart- bzw. Artniveau zu erwägen. Alle in der Untersuchung genannten Unterschiede stehen in Zusammenhang mit den Strukturen der Wirtspflanze. Während alpine Populationen wie oben erwähnt, fast ausschließlich Cirsium spinosissimum als Nahrung verwerten, wurde für die nichtalpinen Populationen ein breit gestreutes Wirtspflanzenspektrum nachgewiesen (3 Arctium spp., 3 Carduus spp., 4 Cirsium spp. und Centaurea scabiosa). Zwar beschränken sich die Tiere an einem Standort in der Wirtswahl, doch werden in der Regel mehrere Wirtspflanzenarten als Nahrungsquelle genutzt. Dadurch wird laut ZWÖLFER (1974) eine zu starke Wirtsabhängigkeit vermieden. ZWÖLFER (1971) gibt die Phänologie und eine Liste der Wirtspflanzen nebst einer Beschreibung der verschiedenen Formen ("Ökotypen") von Larinus sturnus an. Die Ausbildung sogenannter "Ökotypen" oder "Biotypen" innerhalb phytophager Insekten an Cardueae-Blütenköpfen wurde von ZWÖLFER u. ROMSTÖCK-VÖLKL (1991) und ZWÖLFER u. VÖLKL (1993) zusammenfassend dargestellt.
Als phytophage Konkurrenten der alpinen Populationen nennt ZWÖLFER (1974) nur Tephritis conura. Auch für das UG konnte dieser Nachweis erbracht werden. Diese Tephritidae kommt gelegentlich mit L. sturnus vor, befällt aber hauptsächlich Cirsium heterophyllum. Da die Larven von L. sturnus aber ausweichen können, ist die Nahrungs- und Raumkonkurrenz im Gegensatz zu den Tieflandpopulationen, die auf mehr Konkurrenten stoßen können, nicht sehr groß.
Die Larven alpiner L. sturnus-Populationen sind sehr oft von Parasiten befallen. ZWÖLFER (1974) nennt eine bis zu 85%-ige Larvenmortalität durch die Schlupfwespe Exeristes roborator. Diese Art konnte auch für das UG nachgewiesen werden (Fimbertal 2000m; 8.9.88; Adultes Weibchen an Cirsium spinosissimum). Die Tieflandpopulationen werden von mehreren Arten parasitiert. Als Räuber nennt ZWÖLFER die Gattung Lonchaea (Dipt.) und Homoeosoma (Lep.). ZWÖLFER (1974) fand heraus, daß nicht-alpine Populationen von Larinus sturnus in einem wesentlich komplexeren Ökosystem eingebunden sind. Diese Beobachtung konnte im UG bestätigt werden. Es traten neben Larinus sturnus kaum phytophage Insekten an Cirsium spinosissimum auf. Auch die hohe Larvenmortalität und der starke Befall der Wirtspflanze konnte nachgewiesen werden. Die enorm hohen Individuenzahlen sind ein Beweis für die hohe Biomasseproduktivität von Larinus sturnus im Gebirge, die jene von nicht-alpinen Populationen übertrifft. ZWÖLFER sieht den Grund dafür in der hohen Flexibilität und der breiten ökologischen Valenz von alpinen Populationen von Larinus sturnus.
Aufgrund der vielfältigen Faktoren (Seehöhe, Witterungsverlauf, Exposition, Standorteigenschaften) und der Größe des UG war es sehr schwierig, vergleichbare, quantitative Aufsammlungen durchzuführen. Schließlich wurden zwischen 1986 und 1989 an 5 Hauptstandorten (Fimbertal Gampenalpe 2000m; Bielerhöhe 2000m; Idalpe 2500m; Paznauner Thaja 1900m; Jamtal 2000m) und einigen anderen Gebieten 22 quantitative Aufsammlungen durchgeführt, ausgewertet und standardisiert. Insgesamt wurden dabei ca. 300 Blütenköpfe händisch im Gelände oder im Labor auf Entwicklungsstadien von Larinus sturnus abgesucht. Dabei wurde auch zwischen den einzelnen Stadien differenziert. Weiters wurden tote Larven, tote Puppen und verlassene Wohnkammern, die einen Hinweis auf die Zahl der geschlüpften Tiere geben, berücksichtigt. Die Ergebnisse dieser Auswertungen wurden in der Originalarbeit in 17 Diagrammen dargestellt, von denen weiter unten ein Beispiel angegeben ist. Da Larinus sturnus ein Hauptaspekt der vorliegenden Untersuchung war, wurden auch zahlreiche Fotos zur Dokumentation angefertigt.
Die in den folgenden Diagrammen genannten Anzahlen der einzelnen Stadien (Ordinate) beziehen sich immer auf 100 Blütenköpfe. Die Werte wurden standardisiert.