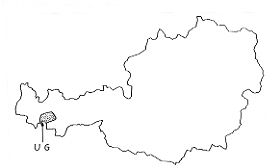
Inhaltsverzeichnis
Diese HTML-Version der Dissertation ist inhaltlich stark gekürzt.
Die Originalarbeit enthält folgende Inhalte:
Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen phytophage Insekten an Compositen (=Asteraceae) in einem montanen bis alpinen Lebensraum.
Es sollten hauptsächlich jene Insekten untersucht werden, die phytophag mehr oder weniger an Compositen gebunden sind. In geringem Umfang waren auch Parasiten und Prädatoren zu berücksichtigen. Dabei sollten bestimmte Genera (z.B.: Cirsium, Carduus , Arnica, Centaurea, Hypochoeris), im Vordergrund stehen.
Als Untersuchungsgebiet wurde ein inneralpines Hochtal (Paznauntal, Wohnort des Verfassers) gewählt. Die oben angeführten Themeneinschränkungen waren notwendig, um die Arbeit in einem vertretbaren Zeitraum abschließen zu können.
Eine recht beachtliche Fülle an Literatur wurde während des Untersuchungszeitraumes studiert und mit den eigenen Ergebnissen verglichen. Leider bezog sich der Großteil der Literatur auf den nichtalpinen Bereich. Insofern wurde mit der vorliegenden Arbeit auch zoologisches Neuland erschlossen.
Am Institut für Zoologie der Universität Innsbruck wurden in den vergangenen 15 Jahren mehrere wissenschaftliche Arbeiten (Diplomarbeiten und Dissertationen) erstellt, die sich mit dem Phytophagenkomplex an ausgewählten Pflanzentaxa beschäftigten: Juniperus communis (EXENBERGER, 1979), Alnus viridis (GRISSEMANN, 1980), Hippophae rhamnoides (REITER, 1981), Microlepidopteren an Rosaceae (HUEMER, 1985).
Der Kleinräumigkeit der Habitate und der damit verbundene vielfältige Flora und Fauna ist es auch zu verdanken, daß die Tier- und Pflanzenwelt im Gebirge durch anthropogene Einflüsse weit geringer in Mitleidenschaft gezogen wurde, als in den großflächigen Ökosystemen des Tieflandes. Dieser Sachverhalt konnte beispielsweise auf der Idalpe bei Ischgl, einem Gebiet, das skitouristisch intensiv genutzt wird und für diesen Zweck durch Erdbewegungen sehr stark verändert wurde, beobachtet werden. Auf den fast vegetationsfreien unstrukturierten Skipisten fanden sich kaum Lepidopteren bzw. Insekten, wenige Meter daneben auf unberührten Steilhängen konnte aber immer wieder eine erstaunlich hohe Arten- und Individuenzahl der genannten Tiere festgestellt werden. Das einzige bisher bekannte Fluggebiet von Erebia flavofasciata in Österreich befindet sich auch unmittelbar neben einer Skipiste (PFEIFER u. BURMANN, 1986). Ausgehend von kleinen aber intakten Refugialräumen können anthropogen veränderte Bereiche der Hochalpen (z.B.: Skipisten) wieder besiedelt werden.
Eine deutliche Artenverarmung sowohl floristisch als auch faunistisch wurde auf beweideten Flächen festgestellt. An solchen Standorten trat aber Cirsium spinosissimum, ein Stickstoffanzeiger, sehr häufig auf. Diese Art war für die vorliegende Untersuchung eine Hauptpflanze.
Distelblütenköpfe als ökologische Kleinsysteme beinhalten im Gebirge weniger Arten und sind in der Artzusammensetzung nicht so komplex wie Distelblütenköpfe im Tiefland (ZWÖLFER, 1980).
Asteraceae (=Compositen) sind eine Pflanzenfamilie, die sich in einem starken Evolutionsschub befindet. Daher gibt es auch eine Vielzahl von Unterarten und Hybriden in den einzelnen Arten, was die Determination nicht gerade einfach macht. Für die vorliegende Untersuchung wurden die Korbblütler nur auf Artniveau bestimmt. Wie aus zahlreichen Arbeiten von ZWÖLFER und seinen Schülern hervorgeht (siehe Literaturverzeichnis), gibt es eine recht kleine Anzahl von Insekten-Taxa, die sich auf Compositen spezialisiert haben. Daher findet man wenige monophage, einige oligophage und ein Heer von polyphagen Insekten oder gelegentlichen Besuchern auf dieser Pflanzenfamilie.
3.1. Lage des Untersuchungsgebietes
Lage des Untersuchungsgebietes in Österreich
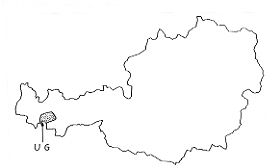
3.2. Beschreibung des Untersuchungsgebietes
Das 40 km lange Paznauntal (kurz Paznaun) liegt im westlichen Nordtirol und wird von der Trisanna entwässert, die sich bei Wiesberg mit der Rosanna aus dem Stanzertal zur Sanna vereinigt. Die Sanna fließt bei Landeck in den Inn. Das Oberpaznaun wird südseitig von der Silvretta, das Unterpaznaun von der Samnaungruppe begrenzt. Im Norden wird das Tal von der Verwallgruppe (auch Ferwall) abgeschlossen. Das Unterpaznaun mit den Orten See und Kappl ist ein enges, tief eingeschnittenes V-Tal, das Oberpaznaun, zu dem die Orte Ischgl und Galtür zählen, ist ein Trogtal und etwas breiter. Charakteristisch sind mehrere bis 20 km lange südliche Seitentäler. Aus dem Norden münden nur einige kurze, steile Nebentäler ein. Die bewaldeten Flanken des Haupttales werden durch zahlreiche Lawinenstriche unterbrochen. Die Talsohle, die Spuren postglazialer Seen im Siedlungsbereich der Ortschaften See und Ischgl aufweist, wird heute als Kulturland genutzt. Oberhalb der Waldgrenze befinden sich Bergmähder und Almen. Die Bereiche Medrigalm bei See, Diasalm bei Kappl, Idalpe bei Ischgl und Wirl - Kops bei Galtür werden als Schigebiet intensiv genutzt.
Einen Überblick über die geologischen Verhältnisse gibt die Geologische Karte von Tirol (Hrsg.: Universität Innsbruck, 1980). Weiteres Kartenmaterial: Geologische Bundesanstalt (Blatt Galtür und Blatt Landeck).
Das Untersuchungsgebiet hat Anteil an 3 verschiegenen geologischen
Zonen:
1) Silvretta-Kristallin (Verschiedene Metamorphite)
2) Engadiner Fenster (Bündner Schiefer und Ophiolithe)
3) Landecker Quarzphyllitzone (Phyllite)
Nähere Ausführungen in der Originalarbeit
Das Paznauntal liegt im Bereich des inneralpinen kontinentalen Klimas mit reichlichen Sommer- und mäßigen Winterniederschlägen. Das Tal erhält die meisten Niederschläge aus dem Westen. Das relativ niedrige Zeinisjoch (1842 m) ist für feuchte Luftmassen ein Hauptdurchzugsweg. Erwartungsgemäß bekommt daher das Oberpaznaun mehr Niederschläge ab, als das Unterpaznaun. Zur Charakterisierung der Witterungsbedingungen wurden Monatsmittelwerte der Temperatur und die Summe der monatlichen Niederschläge der letzten 10 Jahre in den folgenden Diagrammen wiedergegeben. Die Roh-Daten stammen von der Wetterdienststelle Innsbruck und wurden vom Verfasser in Diagrammform umgestaltet. Während des Untersuchungszeitraumes gab es sehr trockene, warme Sommer (z.B.: 1988, 1992, 1994) und sehr regenreiche, kühle Vegetationsperioden (z.B.: 1993).
Jahresniederschläge in Galtür und auf der Idalpe bei Ischgl von 1984 bis 1994 (7 KB).
Monatsmitteltemperaturen Idalpe bei Ischgl (2300m) (5 KB).
Monatlicher Niederschlag Idalpe bei Ischgl (2300m) (5 KB).
Die vielfältigen geologischen Untergrundverhältnisse im UG bedingen besonders im Bereich des Unterengadiner Fensters eine reichhaltige Flora. Die weichen, leicht verwitterbaren Gesteine ergeben gute Alm- und Wiesenböden. Der Wechsel zwischen silikatischem und karbonatischem Untergrund bereichert zusätzlich die Vegetation.
Die folgende Darstellung der Vegetationseinheiten lehnt sich an PITSCHMANN et. al. (1973) an, von denen der Großteil des Gebietes auch kartiert wurde.
1) Fichtenwälder (Piceeta):
Die Talflanken auf Silikatgestein in der montanen und subalpinen
Stufe sind mit Fichtenwäldern bewachsen, die von zahlreichen
Lawinenstrichen und Rodungsflächen (z.B.: Galtür) unterbrochen
sind. In höheren Lagen tritt vermehrt Lärche und Rhododendron
ferrugineum im Unterwuchs dazu.
2) Lärchen-Zirbenwälder (Larici-Cembretum):
Diese Vegetationsform bildet auf Silikat die Waldgrenze in etwa
2000 m Seehöhe. Die Baumgrenze liegt bei ca. 2200 m.
3) Krummholz (Pinetum mugi):
Latschen kommen im UG nur an wenigen Stellen vor (Zeinisjoch,
Sonnenhang bei Galtür, einige Stellen im Fimbertal).
4) Subalpine Augebüsche:
Grünerlenbestände (Alnetum viridis) repräsentieren
an Bachufern und feuchten Berghängen die subalpine Au. Auf
Silikat sind Betula pubescens und Salix hegetschweileri
untermischt. Die gegen mechanische Beanspruchung widerstansfähige
und stocktreibende Grünerle wächst auch in Lawinenstrichen.
5) Zwergstrauchheiden:
Auf sauren Böden, die im UG bei weitem überwiegen,
wachsen auf Sonnenhängen Calluna, Vaccinium und
Rhododendron, weiter oben auch Empetrum und Loiseleuria.
Auf Schattenhängen sind geschlossene Beeren- und Alpenrosenheiden
von Salix helvetica durchsetzt.
6) Alpine Grasheide:
Auf karbonatischem Untergrund treten Grasheiden als Semperviretum
und Firmetum, auf Silikat als Nardetum und Curvuletum
auf. Sie wurden bis mitte der 70-er Jahre hoch hinauf gemäht
und als Almen bewirtschaftet, heute nur mehr auf einigen Almen
beweidet. Schneetälchen, Quellmoore und alpine Schutt- und
Felsvegetation folgen als Vegetationsstufe in höheren Lagen.
7) Äcker, Gärten und Obstbaugebiete:
Im UG spielt der Obstbau keine Rolle. Gärten werden nur in
geringem Maß angelegt. Äcker verschwanden in den letzten
20 Jahren im Oberpaznaun (Galtür, Ischgl) fast völlig
und sind nur noch im Unterpaznaun (Kappl, See) an den sonnseitigen
Talflanken häufig zu sehen.
8) Mähwiesen:
Die Fettwiesen des Talgrundes werden in der Regel zweimal jährlich
gemäht und zum geringeren Teil beweidet. Die Düngung
erfolgt traditionell mit Jauche und Stallmist.
9) Moore:
Im UG ist lediglich am Zeinisjoch ein kleineres Moorgebiet. Ein
weiteres Moor auf der Bielerhöhe wurde im Zuge der Errichtung
des Silvrettastausees nach dem 2. Weltkrieg unter Wasser gesetzt.
Das Untersuchungsgebiet wurde an ca. 100 Exkursionstagen (Mai bis Oktober) in den Jahren 1986 bis 1988 intensiv bearbeitet. Weitere Daten stammen aus einer Vorbereitungsphase 1985, sowie aus den Jahren 1993 und 1994. Im einzelnen kamen dabei folgende Methoden zur Anwendung:
5.1. Handfang
Unbekannte oder neue Insektenarten wurden mit der Hand oder mit dem Fangnetz eingesammelt und in einem Glas mit Schwefeläther, Essigäther oder Zyankali getötet.
5.2. Untersuchung der Pflanzen im Freiland
An mehreren, regelmäßig besuchten Standorten wurde eine bestimmte Anzahl von Pflanzen an Ort und Stelle einer genauen Absuche mit anschließender Sektion unterzogen. Dabei wurde der Hauptsproß vom Ansatz der Blütenköpfe bis zum Wurzelstock mit einem Taschenmesser geöffnet. Die Blütenköpfe wurden von Hand oder ebenfalls mit einem Messer der Länge nach aufgeschnitten. Die Blütenköpfe der besonders stacheligen Arten (C. spinosissimum, C. palustre, C. vulgare) wurden mit Handschuh und Pinzette meist von oben her untersucht. Die Anzahl von Entwicklungsständen bekannter Arten wurden gezählt und sofort protokolliert.
5.3. Sektion von Pflanzenteilen
Um die Sektion abgetrennter Pflanzenteile (besonders Blütenköpfen) noch sorgfältiger vornehmen zu können, wurden Disteln zu Hause geöffnet und untersucht. Dabei zeigten sich keine nennenswerten Unterschiede zur Untersuchung im Gelände.
5.4. Zucht
Larven und Puppen, die an (in) Korbblütlern auftraten, wurden in Plastikdosen zur Weiterentwicklung aufgehoben. Die geschlüpften Tiere wurden ausgewertet. Dabei war zu bemerken, daß durch verschiedene Beeinträchtigungen (Schimmel etc.) viele Insekten sich nicht fertig entwickelten. Daher wurden im Verlauf der Untersuchungen als Zuchtgefäße Glasbehälter, die mit luftdurchlässigem Stoff abgedeckt waren, verwendet. In einigen Fällen dauerte die Entwicklung mehrere Monate.
5.5. Automatische Austreibung
Zur automatischen Austreibung der Insekten aus den Pflanzen wurde eine modifizierte Berlese-Tullgren Apparatur (11 KB) verwendet.
Im Gelände wurde eine bestimmte Anzahl von Pflanzenteilen (meist Blütenköpfen) abgetrennt, in geschlossenen Stoffsäcken in den Untersuchungsraum nach Ischgl (Heimatort des Verfassers) gebracht und 24 bis 72 Stunden Beleuchtung durch eine 100 W Glühbirne ausgesetzt. Dabei betrug der Abstand zwischen Substrat und Birne etwa 8 bis 15 cm. Es war darauf zu achten, daß das trockene Pflanzenmaterial sich nicht entzündete. Die ausgetriebenen Tiere fielen durch ein Gitter in eine Tötungs- und Konservierungsflüssigkeit (verdünnte Pikrinsäure). Anschließend wurden die Proben grobsystematisch ausgewertet. Eine genauere Determination wurde von Spezialisten vorgenommen.
Schematischer Aufbau der modifizierten Berlese-Tullgren Apparatur zur Austreibung von Insekten aus pflanzlichem Substrat.
5.6. Feldbeobachtung
Das Auftreten bekannter Insektenarten sowie der Blütenbesuch durch Lepidopteren wurden beobachtet und in einem Exkursionstagebuch festgehalten.
5.7. Dokumentation und Auswertung
Die quantitativ oder faunistisch wichtigsten Arten wurden in freier Natur auf ihren Nahrungspflanzen mit Zoomobjektiv und Zwischenringen fotografiert. Blätter mit Minen wurden herbarisiert und zum Teil determiniert.
Die getöteten Insekten wurden entweder genadelt oder in 70%-igem Alkohol aufbewahrt. Dabei wurde neben den genauen Funddaten auch die Pflanze, auf der das Tier auftrat, festgehalten. Eine Serie von Tephritidenflügeln wurde für mikroskopische Aufnahmen (64 KB) präpariert.
Nach Abschluß der Feldarbeiten und der Determination wurden alle so gewonnenen Daten mittels Computer in eine Datenbank eingegeben und ausgewertet.
Die Literatur zum Thema wurde erfaßt, intensiv studiert und mit den eigenen Beobachtungen verglichen. H. ZWÖLFER wurde am 20. Juni 1988 zu einem intensiven Fachgespräch in Bayreuth aufgesucht.Mit einer Reihe von Fachleuten bestand regelmäßiger Breifkontakt.
7. Asteraceae im Untersuchungsgebiet
7.1. Bearbeitete Arten
Die Compositen gehören im Untersuchungsgebiet, wie in vergleichbaren Gebieten auch, zu den häufigen bis dominanten Erscheinungen der Vegetation. Manche Arten steigen bis in hohe Regionen auf: Cirsium heterophyllum wurde bis 2000m nachgewiesen. Cirsium spinosissimum wurde noch in 2500m angetroffen . Zu den besonders nennenswerten Arten gehört Cirsium eriophorum (56 KB), die im Gegensatz zu anderen Regionen Tirols im Untersuchungsgebiet überall in der montanen Stufe anzutreffen ist. Weiters Senecio abrotanifolius ssp. tirolensis, wenngleich nur an wenigen Stellen und Achillea macrophylla. Die einzelnen Arten werden in HEGI (1929) Bd VI(2) ausführlich beschrieben.
Es folgt eine Liste der im UG festgestellten und bearbeiteten Asteraceae (Systematik und einige biologische Angaben nach RAUH u. SENGHAS, 1976).
In der 2. Spalte der folgenden Tabelle steht unter "Bed.", welche Bedeutung die Pflanze für die vorliegende Arbeit hatte, bzw. wie intensiv sie untersucht wurde. Dabei werden folgende Abkürzungen verwendet:
-: keine Bedeutung für die Untersuchung od. Einzelbeobachtung
+: geringe Bedeutung für die Untersuchung.
!: wichtige Untersuchungspflanze
Pflanzenname Bed. Bemerkung
Asteroideae
Adenostyles glabra + Schluchtwälder; kalkliebend
Solidago virgaurea + Krummholzregion, Alpenmatten
Solidago canadensis - seit 1992 im Paznauntal
eingewandert
Bellis perennis - auf Rasenflächen
Aster bellidiastrum - feuchte Abhänge; kalkliebend
Aster alpinus + Blütenbesuch
Erigeron uniflorus - steinige Matten; kalkmeidend
Erigeron alpinus - steinige Matten
Antennaria dioica - trockene Wälder und Magermatten
Leontopodium alpinum - im Fimbertal auf
Steinsberger-Lias-Kalken
Gnaphalium supinum - steinige Matten, Schneeböden
Helianthus annuus - in Gärten
Anthemis sp. - Ruderalflächen
Achillea macrophylla - Velilltal; Hochstaudenflur unter
der Alpe
Achillea moschata - Magermatten; klakmeidend
Achillea atrata - Schutt, Schneetälchen,
kalkliebend
Achillea millefolium + Trockenwiesen
Matricaria matricaroides - eingeschleppt
Matricaria chamomilla - vereinzelt verwildert angetroffen
Matricaria inodora - Ruderalflächen
Chrysanthemum leucanthemum ! Trockenhänge; formenreich
Chrysanthemum alpinum + Matten; kalkmeidend
Artemisia mutellina - Felsschutt; Fels
Artemisis genipi - Felsschutt; kalkmeidend
Tussilago farfara (34 KB) ! Frühblüher an Wegrändern
Petasites albus - Frühblüher in feuchten Wäldern
Homogyne alpina + quellige Standorte
Arnica montana (19 KB) ! trockene Matten, Hochmoore;
kalkmeidend
Doronicum grandiflorum + Felsschutt
Senecio carniolicus + = S. incanus carniolicus;
steinige Matten
Senecio abrotanifolius ssp. + Idalpe; kalkmeidend
tirolensis
Senecio doronicum + steinige Matten; kalkliebend
Senecio fuchsii + nährstoffreiche Wälder,
Hochstaudenfluren
Calendula officinalis - in Gärten
Carlina acaulis ! trockene, sonnige Hänge
Carlina vulgaris + sonnige Magerrasen
Carduus defloratus (22 KB) ! Schutthänge; kalkliebend
Carduus personata ! Bachufer, Hochstaudenfluren
Cirsium erisithales + Quellfluren, lichte Wälder
Cirsium oleraceum + feuchte Wiesen
Cirsium spinosissimum (32 KB) ! Gesteinsschutt, Weiden; N-zeiger
Cirsium eriophorum (56 KB) ! Waldrand, Ruderalflächen
Cirsium vulgare + Ödland, Schuttplätze
Cirsium acaule + trockene Wiesen; kalkliebend
Cirsium arvense ! Ruderalflächen, nitrophil
Cirsium heterophyllum ! kalkarme Feuchtwiesen
Cirsium palustre ! feuchte schattige Ruderalflächen
Onopordum acanthium + bei Pians
Centaurea phrygia + Bergwiesen
Centaurea scabiosa (15 KB) + Bergwiesen
Cichorioidae
Hypochoeris uniflora (15 KB) ! humose Matten; sehr häufig
Leontodon hispidus (Bild 23 KB) + Wiesen und Matten
Leontodon helveticus - Matten; kalkmeidend
Picris hieracioides - Lärchwald bei Ischgl
Tragopogon pratense + Unterpaznaun; Wiesen, Straßenrand
Willemetia stipitata - feuchte Wiesen
Taraxacum officinale agg. ! Wiesen, Wegränder
Cicerbita alpina - Hochstaudenfluren
Crepis aurea + steinige Bergwiesen
Hieracium pilosella + trockene Waldlichtungen
Hieracium aurantiacum - Bergwiesen
Hieracium villosum + grasige Abhänge; kalkliebend
Hieracium silvaticum + Waldränder
Hieracium intybaceum + Schutthalden; kalkmeidend