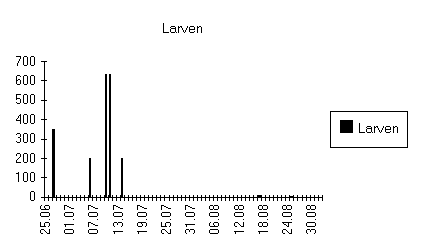8.5.2. Tephritis conura an Cirsium heterophyllum
Foto der Flügelzeichnung (64 KB)
Cirsium heterophyllum ist eine boreo-montane Distelart und weist als Glazialrelikt in Mitteleuropa ein disjunktes Verbreitungsareal auf. Innerhalb der Teilareale kommt sie stetig, bevorzugt an feuchten montanen bis subalpinen Standorten vor. Die Art ist an solchen Standorten im UG überall häufig. Die Pflanze ist im Frühjahr die erste Distel, die ihre Blätter, zeigt und blüht schon im Juni. Im Gegensatz zu anderen Cirsium-Arten (z.B.: Cirsium palustre) ist Cirsium heterophyllum perennierend und vermehrt sich vorwiegend über Rhizome.
Tephritis conura (Dipt.: Tephritidae) ist über weite Teile Europas (Mitteleuropa, Skandinavien, Großbritannien, Alpenraum, Nordspanien, Italien, ehem. Jugoslawien) verbreitet (HENDEL, 1927; ROMSTÖCK, 1986, MERZ, 1994). Die Bohrfliege, deren Hauptwirtspflanze C. heterophyllum ist, daneben weren für Mitteleuropa aber noch weiter 5 Wirtspflanzen angegeben: C. erisithales, C. palustre, C. oleraceum, C. acaule und C. spinosissimum (KOMMA, 1986). Im UG wurde sie neben C. heterophyllum auch an C. spinosissimum und C. oleraceum nachgewiesen.
Die Bohrfliege paart sich schon Anfang Juni (Ischgl, Mutta 1600m am 1. Juni). Die Weibchen legen daher schon recht früh die Eier an die jungen, noch geschlossenen Blütenknospen ab.
Für T. conura konnte eine geographische Differenzierung in der Wirtswahl nachgewisen werden: ROMSTÖCK (1986) unterscheidet in der "Großart" Tephritis conura Loew (1844) 6 Ökotypen von denen im UG zumindest 2 eventuell sogar 3 zu finden sind. Beim ersten Ökotyp handelt es sich um T. conura in der hochalpinen Wirtspflanze Cirsium spinosissimum mit geographisch isoliertem Areal. Ein zweiter Ökotyp von T. conura - dieser scheint im UG zu dominieren - lebt an Cirsium heterophyllum. Schließlich noch ein Ökotyp an Cirsium oleraceum mit kleinräumigen Überlappungen mit Ökotyp 2, wobei die Blühperioden aber um 2 bis 4 Wochen verschoben sein können. KOMMA (1986) weist für einige der Ökotypen eine Mikroevolution im Verhalten bei der Wirtserkennung nach.
Tephritis conura entwickelt sich in 3 Larvenstadien. Das erste Stadium ist allerdings sehr klein, dem Ei ähnlich und häutet sich bald zur L(2). Die weißen Larven leben gesellig in den Blütenköpfen, eng nebeneinander, wo sie sich vom Blütenbodengewebe und von den Fruchtknoten ernähren. In einem Blütenkopf mit 2 cm Durchmesser wurden einmal 34 Larven gefunden. Die Puppendichte in befallenen Blütenköpfen im UG betrug durchschnittlich 7,9. ROMSTÖCK u. ARNOLD (1987) kommen in ihrer Untersuchung zu sehr ähnlichen Werten. Je nach Blütenkopfdurchmesser geben sie Werte zwischen 5,51 und 8,47 an. Die im UG festgestellten maximal 34 Individuen pro Blütenkopf sind anscheinend keine Seltenheit. JANZON (1984) zählte in Schweden einmal 42 Maden bzw. Tönnchen in einem Blütenkopf.
Die Imagines schlüpfen nach einer Puppenruhe von 2 bis 3 Wochen etwa Ende Juli, höher oben Anfang August, an extrem beschatteten Standorten auch erst Anfang September. Die Imagines überwintern. Es zeigte sich ein hoher Parasitierungsgrad. Besonders Pteromalus spp. (Hym.) wurden immer wieder aus den Tönnchen von Tephritis conura gezogen, aber auch im Gelände auf Cirsium heterophyllum-Blütenköpfen beobachtet. Diese Beobachtungen decken sich großteils mit den Angaben in der Literatur. JANZON (1984) nennt für Schweden folgende Parasiten von Tephritis conura: Pteromalus caudiger (GRAHAM, 1969) (Hym.: Pteromalidae), Eurytoma tibialis BOHEMAN, 1836 (Hym.: Eurytomidae) und Crataepus marbis (WALKER, 1839) (Hym.: Eulophidae). Die beiden erstgenannten Arten konnten auch für das UG an Tephritis conura nachgewiesen werden.
Bei den Geländeaufsammlungen wurde beobachtet, daß längst nicht alle Blütenköpfe befallen waren. Der Befall ist von der Anzahl der Cirsium heterophyllum-Pflanzen abhängig. Je massenhafter die Pflanze auftritt, desto geringer der Befall. So wurde in Galtür, Wirl (1650 m) und in See (1000m) an mehreren Standorten mit hunderten Disteln der genannten Art kaum ein befallener Blütenkopf gefunden. Andererseits finden sich an Plätzen mit wenigen C. heterophyllum-Pflanzen (Ischgl, Mutta, 1600m) regelmäßig bis zu 2 Dutzend Tiere (Larven bzw. Puppen) in einem Blütenkopf. Auch der Befall liegt hier weit über 50%. Scheinbar verteilen sich die Tiere bei einem Überangebot an Nahrung sehr stark.
Nach der Verpuppung (Mitte Juli) sind die Tiere (Imagines) sehr leicht zu gewinnen. Es genügt, einige befallene Blütenköpfe im Labor in kleinen Plastikbehältern mit Luftöffnungen zu halten. Dutzende Fliegen schlüpfen innerhalb von 10 Tagen. Tephritis conura kommt im UG vereinzelt auch an anderen Disteln vor, ist aber an Cirsium heterophyllum ein Massentier. Diese Beziehung schien daher geeignet für quantitative Untersuchungen. Es sollten ja in verschiedenen Höhen genügend Tiere gesammelt bzw. beobachtet werden können.
Die Ergebnisse der quantitativen Aufsammlungen wurden in der Originalarbeit in 6 Diagrammen dargestellt.