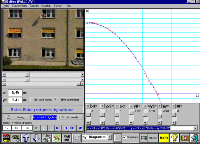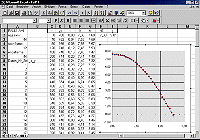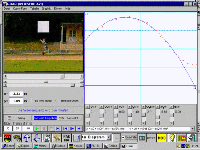Der Computer -
ein multimediales Werkzeug zum Lernen von Physik (Teil II)
Das Projekt
"Galileo" - Videoanalyse von Bewegungsvorgängen
Peter Krahmer; Rolf
Winter; Helmut Mikelskis

Bild 1: Das
Videoauswertungsprogramm "Galileo"
Zielsetzung
Die Videoanalyse von
Bewegungsvorgängen mit Hilfe des Computers ermöglicht eine
praktische Realisierung der didaktischen Forderung nach
Alltagsorientierung von Physikunterricht. Realvorgänge aus dem
Sport, dem Verkehr, vom Jahrmarkt oder aus der Natur können so
auf neue Weise insbesondere den Mechanikunterricht ab Klasse 10
oder 11 lebensnah gestalten helfen.
Mit physikalischen
Denkwerkzeugen auf wirkliche Vorgänge dieser Welt zugehen, ohne
schon gleich das Laborexperiment an den Anfang zu stellen, das
soll im folgenden am Beispiel von "Galileo" (Bild 1)
vorgestellt werden.
Und selbst dann noch, wenn
einmal nicht alles klappt und der frustrierte Computerfreak das
"gute Stück" aus dem Fenster wirft und dem freien Fall
überläßt (Bild 2), ist uns das eine Videoanalyse wert.
Schließlich gehören auch Karikatur und ein Schuß Selbstironie
zum Physiklernen.
Ausgehend von diesen
Erkenntnissen wurde vom Celtis-Gymnasium in Schweinfurt/Franken
(OStR Peter Krahmer) und dem Bereich Didaktik der Physik der
Universität Potsdam (Dr. Rolf Winter) ein gemeinsames Projekt in
Angriff genommen, dessen Ziel darin bestand, ein Video -
Auswertungsprogramm zu entwickeln, mit dem physikalisch
interessante Vorgänge untersucht werden können. Gegenüber den
aus den USA bzw. Frankreich kommenden Entwicklungen (CUPLE,
Videopoint, 2-D Video QT bzw. IMAWIN /1/) sollte es folgende
Vorzüge haben:
- Benutzeroberfläche in
deutscher Sprache,
- bedienerfreundliches
Anpassen einer Modellkurve an die Meßwertkurve (Fitten),
- Angebot als preiswerte
Shareware.
Außerdem sollte eine Sammlung
von didaktisch interessanten und lehrplanrelevanten Videoclips
Bestandteil des Projekts sein.
Das Programm
Die Lernumgebung
"Galileo" (Bild 1) besteht aus den Modulen Videoauswertung,
Modellbildung, Simulation und
Tabellenkalkulation, die miteinander vernetzt sind.
Für das Arbeiten mit Galileo im Unterricht wird folgende
Vorgehen empfohlen:
- Lehrer und Schüler suchen
gemeinsam ein geeignetes Bewegungsphänomen aus.
Gesichtspunkte bei der Auswahl sollten vor allem der
physikalische Gehalt und eine taugliche Kameraperspektive
sein (wenig perspektivische Verzerrungen).
- Herstellen eines
Videoclips dieses Phänomens. Gut geeignet sind
Mitschnitte aus dem Fernsehen (Sportsendungen) und
Videoaufnahmen, die die Schüler selbst angefertigt haben
(Projektarbeit). Im Programmpaket Galileo werden auch
einige von den Autoren hergestellte Clips angeboten.
- Umwandlung des analogen
Videoclips in ein digitales Softwarevideo im Format Video
for Windows (*.AVI -
Datei). Technisch wird das mit einer Videokarte und
entsprechender Software gelöst (zu technischen
Einzelheiten und Problemen siehe /1/). Diese Aufgabe
sollte der Lehrer in der Unterrichtsvorbereitung
tätigen.
- Im Unterricht wird zuerst
die Zeit- und Längeneichung (Kalibrierung) vorgenommen.
Das ist nötig, um später quantitative Auswertungen
durchführen zu können. Außerdem muß der
Koordinatenursprung festgelegt werden.
- Mit der Computermaus als
Meßinstrument wird dann die Position des bewegten
Objekts auf den einzelnen Bildern ausgemessen. In dieser
Phase sind die Schüler tätig. Der Lehrer gibt das
Abtastsystem (x-y, x-t oder y-t) vor und die Schüler
erarbeiten eine Meßwerttabelle. Auf die Koordinaten x
und y und die Zeit als dritte Koordinate ist im
allgemeinen besonders zu achten. Bei Wurfparabeln z.B.
ergeben sowohl die x-y-Ortskurve als auch das
y-t-Diagramm jeweils eine Parabel.
- Die Meßwerttabelle wird
grafisch dargestellt und mit diversen Modellansätzen
verglichen. Die wenigen Modelle, die im Physikunterricht
in Form geschlossener Lösungen relevant sind, können im
Programm aufgerufen werden (siehe Bild 2, unten rechts).
Es sind dies ein x-y-Modell (zeitfreies Modell, z.B. für
Wurfparabeln), ein x-t - bzw. y-t-Modell jeweils in
quadratischer Abhängigkeit von der Zeit (z.B. für Fall,
Beschleunigung, Wurf und viele weitere Themen der
Schulphysik) sowie ein x-t - bzw. y-t-Modell in
sinusförmiger Abhängigkeit von der Zeit (z.B. für
Schwingungen, Drehbewegungen usw.). Die Schüler drehen
an den "Parameterschrauben", die im Programm
durch Schieberegler realisiert werden, und finden die
optimalen Parameter, z.B. den Wert für die
Fallbeschleunigung (fitten).
- An einem zweiten Ansatz,
nämlich dem Vergleich der Messergebnisse mit einer durch
Kraftgesetz und iterativer Simulation generierten
grafischen Darstellung, wird zur Zeit gearbeitet. Die
endgültige Version von Galileo wird dies beinhalten, um
z.B. Reibungsvorgänge im Modellbild beschreiben zu
können. Man kann aber auch externe
Modellbildungsprogramme (z.B. MODUS, STELLA) einsetzen
/1/.
- In bestimmten Fällen
erweist es sich als günstig, zusätzlich zur
Videoanalyse auch noch ein Real-(Labor-)Experiment
durchzuführen. Zum Vergleich der Ergebnisse werden die
ermittelten Daten in ein Tabellenkalkulationsprogramm
exportiert, z.B. EXCEL (siehe Bild 3). Allerdings
funktioniert das nur dann, wenn die Schüler gewisse
Vorkenntnisse im Umgang mit EXCEL besitzen. Ist das nicht
der Fall, kann die Physikstunde auch mal zum
Trainingsfeld für die IT-Bildung (informationstechnische
Bildung) werden. Dies ist in den Rahmenlehrplänen der
meisten Bundesländer auch so vorgesehen. Die Erfahrungen
lassen sich in einer häufigen Schülerreaktion
zusammenfassen: "Warum haben Sie uns den Umgang mit
EXCEL nicht schon früher gezeigt, das ist ja toll!"
- Hausaufgaben und
Tabellenmitschrift ins Heft sind aus methodischer Sicht
nach wie vor dringend anzuraten. Die Schüler betrachten
sonst Filmvorführungen, Videostunden und manche
Computerstunde als Unterhaltungsprogramm. Da läuft
etwas, das der Lehrer später nicht abprüft.
Unterrichtsbeispiel 1:
"Freier Fall"
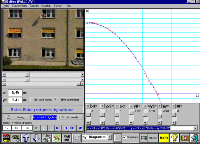
Bild 2
Benutzeroberfläche von Galileo mit AVI-Clip "Fall"
An Hand des Videoclips
"Fall", der in Form einer AVI-Datei im Programmpaket
enthalten ist und den Wurf eines Computers aus dem zweiten Stock
eines Hauses darstellt, soll das Vorgehen noch einmal detailliert
beschrieben werden:
- Die AVI-Datei wird
geladen. Es wird der Meßanfang (erstes auszuwertendes
Frame des Clips) und das Meßende (letztes Frame) mit
Hilfe der Schieberegler festgelegt und diese Auswahl dann
fixiert. Es ist günstig, die kleine Sequenz ein paarmal
ablaufen zu lassen, damit die Schüler Vertrauen in die
Anordnung gewinnen. Der Eichschritt ist ebenso einfach,
da die Höhe des Fensters in den Clip eingeblendet ist.
Ein Mausklick am Anfang, ein Mausklick am Ende, und das
Meßinstrument Maus ist geeicht. Eventuell kann man in
der Oberstufe auf einfache lineare Transformation
eingehen.
- Der Schüler tastet nun
einfach das Bild ab (ohne eine Maustaste zu drücken) und
durcheilt den aus der Realität abgebildeten Bereich. Er
lernt dabei oben, unten, links und rechts den
x-y-Meßwertpaaren zuzuordnen. Je jünger die Schüler
sind, um so wichtiger erscheint gerade diese
vertrauensbildende Maßnahme.
- Nun wird die linke untere
Ecke des Computers als Hot-Spot ausgewählt, und der
Meßwert mit einem Maustastendruck in Grafik und Tabelle
übertragen. Automatisch rückt der Zeiger der Tabelle um
eine Zeile weiter, der zweite Meßwert folgt. Die 10 bis
20 Meßwerte sind schnell ermittelt.
- Jetzt wird das
quadratische Modell mit x(t) und y(t) ausgesucht, wobei
man natürlich im Unterricht die Formeln schon besprochen
haben sollte.
- Als letzter Schritt
erfolgt nun der Vergleich von Modellbild aus diesen
Formeln und den Meßwerten. Die Schüler
legen durch Drehen an den Parameterschrauben
(Schiebereglern) Ausgangshöhe, Startgeschwindigkeit und
Fallbeschleunigung fest, und bereits während des Drehens
ändert sich der Modellgraf im Grafikfenster. Der
Schüler erlebt so aktiv die Bedeutung der Parameter in
den sonst so trockenen Formeln.
- Bei optimaler Deckung wird
der Wert für die Fallbeschleunigung abgelesen. Die
Videoanalyse liefert mit g = (9,8 ± 0,5)m/s2 einen
erstaunlich guten Wert. Dies entspricht einem relativen
Fehler von 5%, und liegt somit trotz der prinzipiellen
Mängel des Verfahrens (siehe /1/) innerhalb der
typischen Genauigkeit in der Schulphysik.
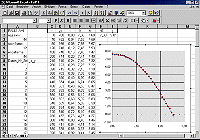
Bild 3 Die Daten
der Videoauswertung werden in ein Tabellenkalkulationssystem, z.
B. EXCEL , exportiert und ausgewertet
Unterrichtsbeispiel 2:
"Weitsprung"
Beispiele aus dem Sport bieten
eine Vielzahl von Möglichkeiten zur physikalisch relevanten
Videoauswertung. Deshalb wurden Videos von Wurfbewegungen sowie
von Stoß- und Schlagvorgängen aufgenommen. Dazu zählen
- Wurf eines Basketballs
- Stoßen einer Kugel
- Treten eines Elfmeters
- Schlagen eines Tennisballs
- Weitsprung.
Eine ausführliche Darstellung
der Videoauswertung dieser Clips im Physikunterricht der
Abiturstufe erfolgt in den Teilen III und IV dieser Reihe
"Der Computer - ein multimediales Werkzeug zum Lernen von
Physik". Deswegen soll hier nur kurz auf die Auswertung des
Weitsprungs eingegangen werden.
Der Videoclip
"Weitsprung.AVI" wird wie im Unterrichtsbeispiel 1
beschrieben in das Programm geladen, Anfang und Ende festgelegt
und die Eichung vorgenommen. Dazu ist in den Clip ein weißes
Quadrat mit der Kantenlänge 1 m eingeblendet. Der
Koordinatenursprung wurde auf den Absprungbalken gelegt. Als
Hot-Spot zur punktweisen Auswertung eignen sich
Körpermittelpunkt oder Kopf des Springers. Die Füße sind z.B.
sollte man nicht nehmen, da sie eine zusätzliche Bewegung
ausführen. Es ergibt sich eine typische Wurfparabel, deren
Parameter aus der Fittingkurve entnommen werden können (Bild 4).
Aus dem y-t-Diagramm kann man z.B. für g = 9,89 m/s² entnehmen.
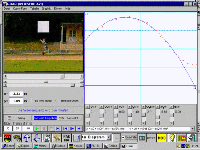
Bild 4 y - t -
Diagramm eines Weitsprungs
Unterrichtsbeispiel 3:
"Frosch"
Aber auch etwas
"fremdere" Bewegungsvorgänge können untersucht
werden. Quakt ein Frosch sinusförmig oder nicht ? Dazu wurde ein
quakender Frosch mit einer Videokamera aufgenommen und in ein
Softwarevideo konvertiert. Nur bei kleinen Amplituden sind fast
alle periodischen Bewegungen sinusförmig (Bild 5).

Bild 5 Auswertung
des Videoclips "Frosch.AVI"
Wie erhält man das
Programm "Galileo"?
Das Programmpaket
"Galileo" enthält das eigentliche Programm Galileo.EXE, eine Beschreibung des Programms
Galileo.TXT sowie einige Videoclips im VfW-Format als AVI-Dateien
(z.B. Fall, Basketballwurf, Elfmeter, Tennis, usw.). Die
Videoclips wurden von einer Arbeitsgruppe des Bereichs
Physikdidaktik der Universität Potsdam (Mikelskis, Seifert,
Winter) hergestellt. Das Paket "Galileo.ZIP" (1
Diskette), das die Dateien Galileo.EXE, Galileo.TXT und Fall.AVI
enthält, ist gegen eine Selbstkostenerstattung von 20,- DM bei
Peter Krahmer (Adresse s.u.) erhältlich. Es läuft auf 486er
Rechnern (und höher) unter Windows. Das Programmpaket ist auch
im Internet abrufbar (bitte das Sharewarekonzept beachten), und
zwar wahlweise über
Über die HomePages und die Teacher’s
Pages kann man sich ständig über weitere Verbesserungen
informieren. An Unterrichtserfahrungen der Leserinnen und Leser
mit dem Programm sind die Autoren sehr interessiert.
| OStR Peter Krahmer Methfesselstr. 18
97074 Würzburg
|
Prof. Dr. Helmut Mikelskis Dr. Rolf Winter
|
Universität Potsdam Institut für Experimentalphysik und
Physikdidaktik
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam
|
Literatur:
/1/ Mikelskis, H.; Seifert, S.;
Winter, R.: Der Computer - ein multimediales Werkzeug zum Lernen
von Physik (1), Multimedia und Hypermedia im Physikunterricht -
eine einführende Übersicht. - In: Physik in der Schule. -
Berlin, 35 (1997) 6 - S. ...)