|
Aktuelle
Science bei MM-Physik |
|
Aktuelle
Science bei MM-Physik |
Momentaufnahmen aus dem Erdaltertum
Paläobotaniker
entwickeln neue Methoden zur Untersuchung von 400 Millionen Jahre
alten Pflanzen.
Pressemitteilung Westfaelische
Wilhelms-Universität Münster, 28.04.2000
Von Brigitte Nussbaum
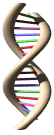 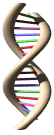 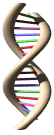 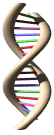 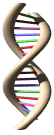 |
Selbst nach fast 400 Millionen Jahren wirken die Pflanzen, als seien sie frisch gepresst. Keime, Stengel, selbst einzelne Zellen lassen sich unter dem Mikroskop erkennen. Die eindrucksvollen Fundstücke aus dem schottischen Rhynie Chert werden in der Forschungsstelle für Paläobotanik der Universität Münster, eine der wenigen dieser Art in Deutschland, untersucht. Anhand der hauchdünnen, zwischen einem Zwanzigstel und einem Zehntel Millimeter dicken Schliffe können die Wissenschaftler unter Leitung von Prof. Dr. Hans Kerp einen Blick in die Frühzeit der Pflanzenwelt werfen. Obwohl das Material selber bereits seit Jahrzehnten bekannt ist, werden doch immer wieder neue Entdeckungen gemacht. Im vergangenen Jahr konnte so beispielsweise der älteste Schlauchpilz der Welt nachgewiesen werden. Der vorzügliche Zustand der Proben rührt daher, dass die Pflanzen in heißen, vulkanischen Brunnen innerhalb von nur wenigen Tagen verkieselt wurden. Anders als bei Abdruckfossilien blieben die Gewebe der Pflanzen weitestgehend erhalten. Das Interesse der Wissenschaftler ist nicht nur die Beschreibung, auch wenn es immer wieder Überraschungen gibt, sondern zunehmend die Ökologie dieser Pflanzen, die Rekonstruktion ganzer Biosysteme und die Interaktion der Pflanzen miteinander. Die Artenvielfalt war damals lange nicht so groß wie heute: An höheren Landpflanzen wurden bisher sieben, an niederen Landpflanzen ein paar Dutzend Arten nachgewiesen. Die blattlosen Pflanzen sind klein, nur etwa 15 bis 25 Zentimeter hoch. Bereits unter Kerps Vorgänger Prof. Dr. Winfried Remy wurde die Forschungsstelle zu einem Schwerpunkt der Devon- Forschung, die das erdgeschichtliche Zeitalter 400 bis 345 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung umfasst. So wurde hier erstmalig der Generationswechsel fossiler Landpflanzen entschlüsselt, wobei sogar Details wie keimende Sporen und Spermien belegt werden können. Durch den Einsatz moderner Kunststoffe ist es möglich, immer präzisere Schnitte zu erstellen und damit sogar verschiedene Zellteilungsstadien zu dokumentieren. Mit der Entwicklung neuer Techniken machte sich das Institut auch bei der Untersuchung von Abdruckfossilien einen Namen. Anders als im Rhynie Chert, das durch die schnelle Bildung der Schichten innerhalb von nur wenigen Tagen eine "Momentaufnahme" der Erdfrühzeit darstellt, können mit Hilfe der Abdruckfossilien Zeiträume von einigen hunderttausend Jahren untersucht werden. Gearbeitet wird vor allem mit Funden aus Steinkohlevorkommen in Zentralfrankreich. Hier ist noch die "Kutikula", das heißt die oberste Hautschicht der Pflanzen erhalten. In ihr sind die Abdrücke der einzelnen Oberflächenzellen zu erkennen. Um diese genauer untersuchen zu können, werden die Steine mit Flusssäure aufgelöst und die zurückbleibenden Kutikulen mit Chemikalien aufgehellt - ein komplexer Vorgang, der in Münster so weiter entwickelt wurde, dass es nun erstmals möglich ist, bis zu etwa zehn Zentimeter große Pflanzenteile zu erhalten. Da die Kutikulen pflanzenspezifisch sind, reichen bereits einige Quadratmillimeter aus, um die Art bestimmen zu können. Auch bei den Abdruckfossilien liegt jedoch das vorrangige Interesse darin, zu erkennen, wie die Pflanzen funktionierten. So lassen sich auch aus Abdruck-Material noch zahlreiche neue Erkenntnisse gewinnen. Beispielsweise konnten mit Hilfe der Kutikular-Untersuchungen eindeutig Ranken und Saugorgane an den Wedeln von Pflanzen nachgewiesen werden - ein Beweis dafür, dass zahlreiche der ältesten Samenpflanzen kletternde, lianenartige Gewächse waren. |
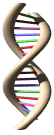 |
Bilder http://idw.tu-clausthal.de/public/zeige_bild?imgid=1121 Gut erhalten selbst nach 300 Jahren ist dieser Abdruck einer Schlingpflanze. http://idw.tu-clausthal.de/public/zeige_bild?imgid=1122 Die Rekonstruktion einer frühen Schlingpflanze lässt das Erdaltertum wieder lebendig werden. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.uni-muenster.de/GeoPalaeontologie/Palaeo/Palbot/bot.htm |