Der ehemalige Lesehof des Hochstiftes Passau in Klosterneuburg
Baugeschichte und Rekonstruktion
Gebäude B: "Kellergebäude"
 Annähernd parallel zum Gebäude A wurde in einer
zweiten Phase Gebäude B errichtet. Der in das Bodenniveau eingetiefte rechteckige
Keller von 10 x 6 m lichter Weite bei einer Mauerstärke von 1,1 m ist architektonisch
am besten erhalten. Im Grundriß zeichnet sich ein klar von Gebäude
A zu unterscheidendes architektonisches Gefüge ab. An der Stirnseite, wo
der achsial liegende Kellerabgang erhalten blieb, befindet sich an der Ostecke
ein diagonal anlaufender Strebepfeiler. Sein Pendant bildet die Zungenmauer
von Gebäude A, welche im Aufgehenden von der Ecke des Gebäudes B umfangen
wird. Das Kellergebäude B ist daher stratigraphisch jünger als der
"Chorhof" A. Ein weiteres Strebepfeilerpaar befindet sich in der Mitte
der Längswand. Die Rückwand hatte an der Westecke kreuzförmig
angeordnete Strebepfeiler, während sie sich an der Nordecke nach einem
Knick in der Bauflucht noch mindestens 10 m fortsetzte. Im Gegensatz zum "Chorhof"
A ist das Kellergebäude B als voll ausgebildeter gotischer Strebepfeilerbau
anzusprechen. Die Anlage von relativ eng stehenden Strebepfeilern an einem doch
relativ kleinen Bau läßt auf ein schweres Gewölbe, etwa ein
Kreuzgratgewölbe, schließen. Außerdem scheinen beim Bau in
der Nordecke massive statische Probleme aufgetaucht zu sein, den hier greifen
zwei Konterbögen über die Ecke hinweg. Das an dieser Stelle schräg
nach Norden abfallende Gelände, die Konterbögen, das Abschwenken der
Bauflucht und die relativ massiven und eng gesetzten Strebepfeiler sind offensichtlich
durch die instabile Statik des Geländes (ein ehemaliger Bachverlauf?) bedingt.
Die Lösung des Problems mit Konterbögen an der Fundamentsohle deutet
jedenfalls auf einen erfahrenen Baumeister hin.
Annähernd parallel zum Gebäude A wurde in einer
zweiten Phase Gebäude B errichtet. Der in das Bodenniveau eingetiefte rechteckige
Keller von 10 x 6 m lichter Weite bei einer Mauerstärke von 1,1 m ist architektonisch
am besten erhalten. Im Grundriß zeichnet sich ein klar von Gebäude
A zu unterscheidendes architektonisches Gefüge ab. An der Stirnseite, wo
der achsial liegende Kellerabgang erhalten blieb, befindet sich an der Ostecke
ein diagonal anlaufender Strebepfeiler. Sein Pendant bildet die Zungenmauer
von Gebäude A, welche im Aufgehenden von der Ecke des Gebäudes B umfangen
wird. Das Kellergebäude B ist daher stratigraphisch jünger als der
"Chorhof" A. Ein weiteres Strebepfeilerpaar befindet sich in der Mitte
der Längswand. Die Rückwand hatte an der Westecke kreuzförmig
angeordnete Strebepfeiler, während sie sich an der Nordecke nach einem
Knick in der Bauflucht noch mindestens 10 m fortsetzte. Im Gegensatz zum "Chorhof"
A ist das Kellergebäude B als voll ausgebildeter gotischer Strebepfeilerbau
anzusprechen. Die Anlage von relativ eng stehenden Strebepfeilern an einem doch
relativ kleinen Bau läßt auf ein schweres Gewölbe, etwa ein
Kreuzgratgewölbe, schließen. Außerdem scheinen beim Bau in
der Nordecke massive statische Probleme aufgetaucht zu sein, den hier greifen
zwei Konterbögen über die Ecke hinweg. Das an dieser Stelle schräg
nach Norden abfallende Gelände, die Konterbögen, das Abschwenken der
Bauflucht und die relativ massiven und eng gesetzten Strebepfeiler sind offensichtlich
durch die instabile Statik des Geländes (ein ehemaliger Bachverlauf?) bedingt.
Die Lösung des Problems mit Konterbögen an der Fundamentsohle deutet
jedenfalls auf einen erfahrenen Baumeister hin.
 An der Südwestseite des Kellerraumes hat sich eine alternierende
Reihe von steil abfallenden Fenstersohlbänken und flachen Rechtecknischen
erhalten. An der gegenüberliegenden Längswand, die stark durch spätere
Eingriffe gestört war, kann eine ähnliche Konzeption rekonstruiert
werden. In der Stirnwand sind beiderseits des Eingangs zwei in Höhe und
Konstruktion unterschiedliche Nischen angebracht, welche vermuten lassen, daß
auch hier eine spätere Abänderung im baulichen Konzept notwendig war.
An der Südwestseite des Kellerraumes hat sich eine alternierende
Reihe von steil abfallenden Fenstersohlbänken und flachen Rechtecknischen
erhalten. An der gegenüberliegenden Längswand, die stark durch spätere
Eingriffe gestört war, kann eine ähnliche Konzeption rekonstruiert
werden. In der Stirnwand sind beiderseits des Eingangs zwei in Höhe und
Konstruktion unterschiedliche Nischen angebracht, welche vermuten lassen, daß
auch hier eine spätere Abänderung im baulichen Konzept notwendig war.
Das Kellergebäude diente, wie Funde nahelegen, der Weinlagerung. Die
erforderliche Belüftung erfolgte durch die seitlichen Fensterreihen an
den Längswänden, wobei querrechteckige Fensterrahmungen anzunehmen
sind. In der Regel sind solche Keller gewölbt.
Die Fortsetzung des Kellergebäudes nach NO bildet eine in Dimensionierung
und Struktur dem Hauptbau gleichartige Mauer. Ob sich zu diesem Zeitpunkt hier
bereits weitere Massivbauten befunden haben, kann wegen der Störungen durch
spätere Einbauten nicht mit Sicherheit entschieden werden. Zumindest die
nordöstliche Längsmauer des Kellergebäudes B blieb zunächst
unverbaut, wie aus der Lage des mittleren Strebepfeilers an der nordöstlichen
Längsmauer abzuleiten ist. Erst mit der Errichtung des stratigraphisch
jüngsten Gebäudes E wurde die Langseite des Kellergebäudes B
verbaut. Wie noch gezeigt werden soll, geschah dies wahrscheinlich im späteren
15. Jahrhundert.
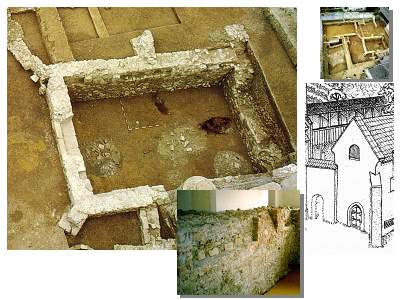 Eine engere Datierung des Kellergebäudes B erweist sich
als schwierig. Der "Chorhof" A trägt mit seiner architektonischen
Gliederung durch Ecklisenen noch altertümliche Züge aus der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts. Das Baugefüge und der Typus des Kellergebäudes
mit seinem stilistisch fortschrittlicheren Strebesystem könnte schon bald
danach entstanden sein. Im 15. Jahrhundert, als man Gebäude E errichtete,
bestand das Kellergebäude jedenfalls schon längere Zeit. Als Kriterium
für eine nähere zeitliche Differenzierung von "Chorhof"
A und Kellergebäude B soll die Struktur des Mauerwerks herangezogen werden.
Eine engere Datierung des Kellergebäudes B erweist sich
als schwierig. Der "Chorhof" A trägt mit seiner architektonischen
Gliederung durch Ecklisenen noch altertümliche Züge aus der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts. Das Baugefüge und der Typus des Kellergebäudes
mit seinem stilistisch fortschrittlicheren Strebesystem könnte schon bald
danach entstanden sein. Im 15. Jahrhundert, als man Gebäude E errichtete,
bestand das Kellergebäude jedenfalls schon längere Zeit. Als Kriterium
für eine nähere zeitliche Differenzierung von "Chorhof"
A und Kellergebäude B soll die Struktur des Mauerwerks herangezogen werden.
Die Mauern der Gebäude A und B bestehen aus örtlichem Flyschsandstein.
Sie sind Schalenmauern, wobei die Mauerspeise zwischen den beiden Bruchsteinschalen
als Mörtel-Stein-Gemisch eingebracht wird. Der Aufbau erfolgt in einzelnen
Schichtkompartimenten, welche von sorgfältigen horizontal ausgerichteten
Ausgleichsschichten kleinerer Steinformate gegliedert werden.
Beim Mauerwerk des Gebäudes A wird versucht, die einzelne Schichthöhe
durch geeignete Steingrößen beizubehalten. Es finden sich sehr häufig
kleine Steinplättchen als Ausgleich pro Schicht; vereinfacht ausgedrückt,
die Mauer wird Schicht für Schicht angepaßt.
Auch das Mauerwerk B verläuft in Schichten, allerdings werden diese
zu jeweils 0,4 bis 0,5 m hohen Paketen zusammengefaßt und dann durch plattige
Steinlagen horizontal abgeglichen. Dadurch ergibt sich optisch eine oft über
die gesamte Länge der Mauer durchlaufende "Bänderung". Innerhalb
dieser Schichtpakete erfolgt abschnittsweise ein rascher Wechsel in den Steinformaten.
Aus allgemeinen Untersuchungen zum mittelalterlichen Bruchsteinmauerwerks
ist bekannt, daß die Entwicklung vom Schicht für Schicht verlegten
Mauerwerk zu immer höheren Schichtpaketen übergeht, wobei im ausgehenden
Mittelalter die Höhe der Ausgleichschichten mit den Arbeitshöhen (1
- 1,5 m) zusammenfällt. Die Regellosiigkeit des Mauerwerks zwischen den
Schichten nimmt ebenfalls zu, bis schließlich in der frühen Neuzeit
der Übergang zum vollkommen regellosen Bruchsteinmauerwerk erfolgt.
Aus der Sicht dieser hier nur sehr grob angedeuteten Entwicklung - sie stellt
bloß eine Variante dar - geht hervor, daß das Mauerwerk des Gebäudes
A den älteren Typus vertritt, andererseits zeigt das Mauerwerk des Gebäudes
B noch nicht die Merkmale eines Mauerwerks des späteren 14. Jahrhunderts.
weiter (Bau C und D) ...
Studiolo | Inhalt
| Einleitung | Befunde
| Zusammenfassung
© studiolo
21.06.99 18:57
 Annähernd parallel zum Gebäude A wurde in einer
zweiten Phase Gebäude B errichtet. Der in das Bodenniveau eingetiefte rechteckige
Keller von 10 x 6 m lichter Weite bei einer Mauerstärke von 1,1 m ist architektonisch
am besten erhalten. Im Grundriß zeichnet sich ein klar von Gebäude
A zu unterscheidendes architektonisches Gefüge ab. An der Stirnseite, wo
der achsial liegende Kellerabgang erhalten blieb, befindet sich an der Ostecke
ein diagonal anlaufender Strebepfeiler. Sein Pendant bildet die Zungenmauer
von Gebäude A, welche im Aufgehenden von der Ecke des Gebäudes B umfangen
wird. Das Kellergebäude B ist daher stratigraphisch jünger als der
"Chorhof" A. Ein weiteres Strebepfeilerpaar befindet sich in der Mitte
der Längswand. Die Rückwand hatte an der Westecke kreuzförmig
angeordnete Strebepfeiler, während sie sich an der Nordecke nach einem
Knick in der Bauflucht noch mindestens 10 m fortsetzte. Im Gegensatz zum "Chorhof"
A ist das Kellergebäude B als voll ausgebildeter gotischer Strebepfeilerbau
anzusprechen. Die Anlage von relativ eng stehenden Strebepfeilern an einem doch
relativ kleinen Bau läßt auf ein schweres Gewölbe, etwa ein
Kreuzgratgewölbe, schließen. Außerdem scheinen beim Bau in
der Nordecke massive statische Probleme aufgetaucht zu sein, den hier greifen
zwei Konterbögen über die Ecke hinweg. Das an dieser Stelle schräg
nach Norden abfallende Gelände, die Konterbögen, das Abschwenken der
Bauflucht und die relativ massiven und eng gesetzten Strebepfeiler sind offensichtlich
durch die instabile Statik des Geländes (ein ehemaliger Bachverlauf?) bedingt.
Die Lösung des Problems mit Konterbögen an der Fundamentsohle deutet
jedenfalls auf einen erfahrenen Baumeister hin.
Annähernd parallel zum Gebäude A wurde in einer
zweiten Phase Gebäude B errichtet. Der in das Bodenniveau eingetiefte rechteckige
Keller von 10 x 6 m lichter Weite bei einer Mauerstärke von 1,1 m ist architektonisch
am besten erhalten. Im Grundriß zeichnet sich ein klar von Gebäude
A zu unterscheidendes architektonisches Gefüge ab. An der Stirnseite, wo
der achsial liegende Kellerabgang erhalten blieb, befindet sich an der Ostecke
ein diagonal anlaufender Strebepfeiler. Sein Pendant bildet die Zungenmauer
von Gebäude A, welche im Aufgehenden von der Ecke des Gebäudes B umfangen
wird. Das Kellergebäude B ist daher stratigraphisch jünger als der
"Chorhof" A. Ein weiteres Strebepfeilerpaar befindet sich in der Mitte
der Längswand. Die Rückwand hatte an der Westecke kreuzförmig
angeordnete Strebepfeiler, während sie sich an der Nordecke nach einem
Knick in der Bauflucht noch mindestens 10 m fortsetzte. Im Gegensatz zum "Chorhof"
A ist das Kellergebäude B als voll ausgebildeter gotischer Strebepfeilerbau
anzusprechen. Die Anlage von relativ eng stehenden Strebepfeilern an einem doch
relativ kleinen Bau läßt auf ein schweres Gewölbe, etwa ein
Kreuzgratgewölbe, schließen. Außerdem scheinen beim Bau in
der Nordecke massive statische Probleme aufgetaucht zu sein, den hier greifen
zwei Konterbögen über die Ecke hinweg. Das an dieser Stelle schräg
nach Norden abfallende Gelände, die Konterbögen, das Abschwenken der
Bauflucht und die relativ massiven und eng gesetzten Strebepfeiler sind offensichtlich
durch die instabile Statik des Geländes (ein ehemaliger Bachverlauf?) bedingt.
Die Lösung des Problems mit Konterbögen an der Fundamentsohle deutet
jedenfalls auf einen erfahrenen Baumeister hin. An der Südwestseite des Kellerraumes hat sich eine alternierende
Reihe von steil abfallenden Fenstersohlbänken und flachen Rechtecknischen
erhalten. An der gegenüberliegenden Längswand, die stark durch spätere
Eingriffe gestört war, kann eine ähnliche Konzeption rekonstruiert
werden. In der Stirnwand sind beiderseits des Eingangs zwei in Höhe und
Konstruktion unterschiedliche Nischen angebracht, welche vermuten lassen, daß
auch hier eine spätere Abänderung im baulichen Konzept notwendig war.
An der Südwestseite des Kellerraumes hat sich eine alternierende
Reihe von steil abfallenden Fenstersohlbänken und flachen Rechtecknischen
erhalten. An der gegenüberliegenden Längswand, die stark durch spätere
Eingriffe gestört war, kann eine ähnliche Konzeption rekonstruiert
werden. In der Stirnwand sind beiderseits des Eingangs zwei in Höhe und
Konstruktion unterschiedliche Nischen angebracht, welche vermuten lassen, daß
auch hier eine spätere Abänderung im baulichen Konzept notwendig war.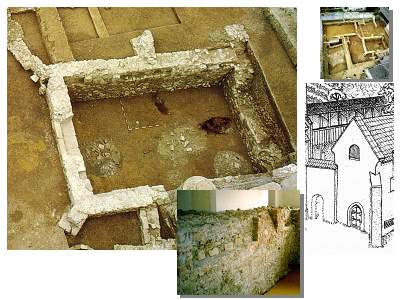 Eine engere Datierung des Kellergebäudes B erweist sich
als schwierig. Der "Chorhof" A trägt mit seiner architektonischen
Gliederung durch Ecklisenen noch altertümliche Züge aus der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts. Das Baugefüge und der Typus des Kellergebäudes
mit seinem stilistisch fortschrittlicheren Strebesystem könnte schon bald
danach entstanden sein. Im 15. Jahrhundert, als man Gebäude E errichtete,
bestand das Kellergebäude jedenfalls schon längere Zeit. Als Kriterium
für eine nähere zeitliche Differenzierung von "Chorhof"
A und Kellergebäude B soll die Struktur des Mauerwerks herangezogen werden.
Eine engere Datierung des Kellergebäudes B erweist sich
als schwierig. Der "Chorhof" A trägt mit seiner architektonischen
Gliederung durch Ecklisenen noch altertümliche Züge aus der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts. Das Baugefüge und der Typus des Kellergebäudes
mit seinem stilistisch fortschrittlicheren Strebesystem könnte schon bald
danach entstanden sein. Im 15. Jahrhundert, als man Gebäude E errichtete,
bestand das Kellergebäude jedenfalls schon längere Zeit. Als Kriterium
für eine nähere zeitliche Differenzierung von "Chorhof"
A und Kellergebäude B soll die Struktur des Mauerwerks herangezogen werden.