Der ehemalige Lesehof des Hochstiftes Passau in Klosterneuburg
Baugeschichte und Rekonstruktion
Gebäude C und D: Turm und Begrenzungsmauer
mit Laufgang
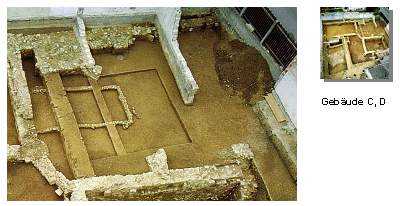 An der Westecke des "Chorhofes" A schließt
in Verlängerung der Bauflucht ein im Grundriß annähernd quadratisches
Gebäude C von rund 3, 5 m Ausmaß an. An dessen Nordecke bindet ein
einzelner diagonaler Strebepfeiler ein. Das bis auf 2,5 m unter das ehemalige
Außenniveau fundamentierte Gebäude ist unschwer als Turm zu interpretieren,
der an seiner "Feldseite" zwischen der Westecke des "Chorhofes"
A und an seiner anderen Ecke durch eine freistehende Mauer (D) in Fortsetzung
der Kapellenflucht statisch eingespannt ist. Die "freie Ecke" sichert
der diagonale Strebepfeiler. An diesem statischen System wird deutlich, daß,
vom architektonischen Konzept her gesehen, die freistehende Mauerflucht baulich
für die Sicherung des Turmes notwendig ist. Diese mit Fuge an den Turm
angebaute Mauer zeigt jedenfalls, daß der Baumeister um das unterschiedliche
Setzungsverhalten zwischen derart abweichend fundamentierten Baukörpern
wußte.
An der Westecke des "Chorhofes" A schließt
in Verlängerung der Bauflucht ein im Grundriß annähernd quadratisches
Gebäude C von rund 3, 5 m Ausmaß an. An dessen Nordecke bindet ein
einzelner diagonaler Strebepfeiler ein. Das bis auf 2,5 m unter das ehemalige
Außenniveau fundamentierte Gebäude ist unschwer als Turm zu interpretieren,
der an seiner "Feldseite" zwischen der Westecke des "Chorhofes"
A und an seiner anderen Ecke durch eine freistehende Mauer (D) in Fortsetzung
der Kapellenflucht statisch eingespannt ist. Die "freie Ecke" sichert
der diagonale Strebepfeiler. An diesem statischen System wird deutlich, daß,
vom architektonischen Konzept her gesehen, die freistehende Mauerflucht baulich
für die Sicherung des Turmes notwendig ist. Diese mit Fuge an den Turm
angebaute Mauer zeigt jedenfalls, daß der Baumeister um das unterschiedliche
Setzungsverhalten zwischen derart abweichend fundamentierten Baukörpern
wußte.
 Die freie Begrenzungsmauer D weist noch ein weiteres ungewöhnliches
bautechnisches Detail auf. Wahrscheinlich wurden vor dem Hochziehen der Mauer
im Abstand von 1,8 - 2 m quadratische Pfosten errichtet, welche wesentlich tiefer
als die Mauer fundamentiert waren. Im Querschnitt werden die Pfosten halb vom
Mauerwerk umfangen bzw. wurden sie unmittelbar nach dem Aufrichten ummauert.
Die tiefere Fundamentierung der Pfosten gegenüber der Mauer und ihr Einbeziehen
in den Mauerverband stellt eine fachwerkartige Aussteiffung des Mauerwerks dar
- ein weiterer Hinweis auf Probleme mit deer Bodenfestigkeit. Allerdings wäre
es dazu nicht notwendig gewesen, die Pfosten nur halb einzumauern. Beispiele
von Mauerankern und vertikalen Balkenlagen im Mauerwerk finden sich während
des gesamten Mittelalters im Wehrba. Es liegt der Schluß nahe, daß
diese Pfosten sekundär für einen Laufgang dienten, welcher außerdem
den Zugang zum Turm ermöglichte. Letzterer bietet ja bei einer lichten
Weite von knapp 2 m kaum Platz für eine Innentreppe.
Die freie Begrenzungsmauer D weist noch ein weiteres ungewöhnliches
bautechnisches Detail auf. Wahrscheinlich wurden vor dem Hochziehen der Mauer
im Abstand von 1,8 - 2 m quadratische Pfosten errichtet, welche wesentlich tiefer
als die Mauer fundamentiert waren. Im Querschnitt werden die Pfosten halb vom
Mauerwerk umfangen bzw. wurden sie unmittelbar nach dem Aufrichten ummauert.
Die tiefere Fundamentierung der Pfosten gegenüber der Mauer und ihr Einbeziehen
in den Mauerverband stellt eine fachwerkartige Aussteiffung des Mauerwerks dar
- ein weiterer Hinweis auf Probleme mit deer Bodenfestigkeit. Allerdings wäre
es dazu nicht notwendig gewesen, die Pfosten nur halb einzumauern. Beispiele
von Mauerankern und vertikalen Balkenlagen im Mauerwerk finden sich während
des gesamten Mittelalters im Wehrba. Es liegt der Schluß nahe, daß
diese Pfosten sekundär für einen Laufgang dienten, welcher außerdem
den Zugang zum Turm ermöglichte. Letzterer bietet ja bei einer lichten
Weite von knapp 2 m kaum Platz für eine Innentreppe.
Für eine nähere Datierung dieser beiden Bauphasen fehlen unmittelbar
datierbare Baudetails, doch können unter anderem die bautechnischen Lösungen
herangezogen werden. Der erstaunlich hoch entwickelte Umgang in der Lösung
von statischen Problemen und die damit verbundene Differenzierung in der Bautechnik
erinnert an den Baumeister des Kellergebäudes B mit seinem Strebesystem
und den Konterbögen. Es läge also nahe, auch den Turm und die anschließende
feldseitige Begrenzungsmauer im zeitlichen, wenn nicht sogar personellen Zusammenhang
mit dem Erbauer des Kellergebäudes B zu sehen. In dieser Bauphase wurde
anscheinend das gesamte Areal des Lesehofkomplexes einer Umbau- und Erweiterungsphase
unterworfen, welche auch den älteren Bau des "Chorhofes" aus
dem 13. Jahrhundert (Neugestaltung des Kapellenraumes?) betrifft. Darin liegt
möglicherweise eine Erklärung für die Bedeutung des "campanileartigen"
Turmes C, den man im Zusammenhang mit der Kapelle im "Chorhof" und
einem nach außen sichtbaren Zeichen der Repräsentation sehen sollte.
Die Erstreckung der Verbauuung zwischen "Chorhof" A, Turm C, Begrenzungsmauer
D und Kellergebäude "B" nach Nordwesten konnte nicht ergraben
werden. Die Parzellenstruktur, der Geländeverlauf und die Baufluchten lassen
vermuten, daß hier ein annähernd rechteckiger Binnenhof zu rekonstruieren
ist. Dafür spricht auch eine an die Nordwestmauer des "Chorhofes"
angebaute, kaum fundamentierte Mauer von maximal 0,3 m Stärke, die am ehesten
als Begrenzung für eine gärtnerische Nutzfläche zu deuten ist.
weiter (Bau E) ...
Studiolo | Inhalt
| Einleitung | Befunde
| Zusammenfassung
© studiolo
21.06.99 18:57
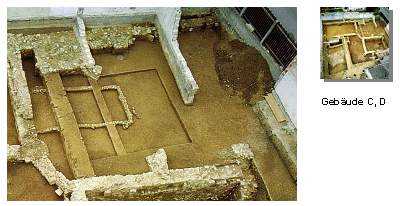 An der Westecke des "Chorhofes" A schließt
in Verlängerung der Bauflucht ein im Grundriß annähernd quadratisches
Gebäude C von rund 3, 5 m Ausmaß an. An dessen Nordecke bindet ein
einzelner diagonaler Strebepfeiler ein. Das bis auf 2,5 m unter das ehemalige
Außenniveau fundamentierte Gebäude ist unschwer als Turm zu interpretieren,
der an seiner "Feldseite" zwischen der Westecke des "Chorhofes"
A und an seiner anderen Ecke durch eine freistehende Mauer (D) in Fortsetzung
der Kapellenflucht statisch eingespannt ist. Die "freie Ecke" sichert
der diagonale Strebepfeiler. An diesem statischen System wird deutlich, daß,
vom architektonischen Konzept her gesehen, die freistehende Mauerflucht baulich
für die Sicherung des Turmes notwendig ist. Diese mit Fuge an den Turm
angebaute Mauer zeigt jedenfalls, daß der Baumeister um das unterschiedliche
Setzungsverhalten zwischen derart abweichend fundamentierten Baukörpern
wußte.
An der Westecke des "Chorhofes" A schließt
in Verlängerung der Bauflucht ein im Grundriß annähernd quadratisches
Gebäude C von rund 3, 5 m Ausmaß an. An dessen Nordecke bindet ein
einzelner diagonaler Strebepfeiler ein. Das bis auf 2,5 m unter das ehemalige
Außenniveau fundamentierte Gebäude ist unschwer als Turm zu interpretieren,
der an seiner "Feldseite" zwischen der Westecke des "Chorhofes"
A und an seiner anderen Ecke durch eine freistehende Mauer (D) in Fortsetzung
der Kapellenflucht statisch eingespannt ist. Die "freie Ecke" sichert
der diagonale Strebepfeiler. An diesem statischen System wird deutlich, daß,
vom architektonischen Konzept her gesehen, die freistehende Mauerflucht baulich
für die Sicherung des Turmes notwendig ist. Diese mit Fuge an den Turm
angebaute Mauer zeigt jedenfalls, daß der Baumeister um das unterschiedliche
Setzungsverhalten zwischen derart abweichend fundamentierten Baukörpern
wußte. Die freie Begrenzungsmauer D weist noch ein weiteres ungewöhnliches
bautechnisches Detail auf. Wahrscheinlich wurden vor dem Hochziehen der Mauer
im Abstand von 1,8 - 2 m quadratische Pfosten errichtet, welche wesentlich tiefer
als die Mauer fundamentiert waren. Im Querschnitt werden die Pfosten halb vom
Mauerwerk umfangen bzw. wurden sie unmittelbar nach dem Aufrichten ummauert.
Die tiefere Fundamentierung der Pfosten gegenüber der Mauer und ihr Einbeziehen
in den Mauerverband stellt eine fachwerkartige Aussteiffung des Mauerwerks dar
- ein weiterer Hinweis auf Probleme mit deer Bodenfestigkeit. Allerdings wäre
es dazu nicht notwendig gewesen, die Pfosten nur halb einzumauern. Beispiele
von Mauerankern und vertikalen Balkenlagen im Mauerwerk finden sich während
des gesamten Mittelalters im Wehrba. Es liegt der Schluß nahe, daß
diese Pfosten sekundär für einen Laufgang dienten, welcher außerdem
den Zugang zum Turm ermöglichte. Letzterer bietet ja bei einer lichten
Weite von knapp 2 m kaum Platz für eine Innentreppe.
Die freie Begrenzungsmauer D weist noch ein weiteres ungewöhnliches
bautechnisches Detail auf. Wahrscheinlich wurden vor dem Hochziehen der Mauer
im Abstand von 1,8 - 2 m quadratische Pfosten errichtet, welche wesentlich tiefer
als die Mauer fundamentiert waren. Im Querschnitt werden die Pfosten halb vom
Mauerwerk umfangen bzw. wurden sie unmittelbar nach dem Aufrichten ummauert.
Die tiefere Fundamentierung der Pfosten gegenüber der Mauer und ihr Einbeziehen
in den Mauerverband stellt eine fachwerkartige Aussteiffung des Mauerwerks dar
- ein weiterer Hinweis auf Probleme mit deer Bodenfestigkeit. Allerdings wäre
es dazu nicht notwendig gewesen, die Pfosten nur halb einzumauern. Beispiele
von Mauerankern und vertikalen Balkenlagen im Mauerwerk finden sich während
des gesamten Mittelalters im Wehrba. Es liegt der Schluß nahe, daß
diese Pfosten sekundär für einen Laufgang dienten, welcher außerdem
den Zugang zum Turm ermöglichte. Letzterer bietet ja bei einer lichten
Weite von knapp 2 m kaum Platz für eine Innentreppe.