Erstpublikation in: Beiträge zur
Mittelalterarchäologie Österreichs 1, 1985, 48 - 57, Taf. 20 -
22.
Ergänzte (Fotos) Online-Version. Bei Zitation Erstpublikation
verwenden.
ARCHÄOLOGISCH-KUNSTHISTORISCHE
UNTERSUCHUNGEN IN DER PFARRKIRCHE ST. MARTIN IN
ATTERSEE/OBERÖSTERREICH.
Von RUDOLF KOCH. Wien
I.
EINLEITUNG
2.
FORSCHUNGSLAGE
3. BESCHREIBUNG DER
BESTEHENDEN KIRCHE
Wie schon KLAAR (1975) 8) erkannte, besteht die
heutige Martinskirche (St. Martin II) im Kern seit spätgotischer
Zeit. Der Typus des einschiffigen Saalraumes mit gleich breitem,
etwas abgeflachten Polygonchor stellt eine einfache, im 15.
Jahrhundert häufig angewandte Grundrißlösung bei Dorfkirchen
dar, welche auf eine Vereinheitlichung des Kirchenraumes abzielt
9). Kirchen, wie in Geretsberg (BH. Braunau), Gstaig (BH.
Braunau), Holzhausen (BH. Wels), Lochen (BH. Braunau), Pulgarn
(BH. Urfahr), Sarleinsbach (BH. Rohrbach) und Utzenaich (BH.
Ried) belegen in Oberösterreich die Verwendung dieses Typus auf
breiterer Basis 10). Die Ausstattung mit Netzrippengewölben - in
Attersee als Dreiparallelrippenfiguration - gehörte zum
beliebten Formenrepertoire der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts.
 Nach
Abnahme der Holzverkleidung im Chor konnten an der nördlichen
Polygonfläche die Reste eines freskierten Medaillons mit der
Halbfigur des Johannes Evangelista entdeckt werden, welches ins
3. Drittel des 15. Jahrhunderts zu datieren ist. Spuren weiterer
Medaillons zeigten sich an der Nordseite des Chores, sodaß
ursprünglich der Hauptaltar an den Wänden von den vier
Evangelistensymbolen umgeben vorzustellen ist. Unterhalb der
Medaillons umzog ein gelbes Vorhangmotiv auf weißem Grund und
zwischen marmorierten Halbsäulen das Presbyterium. Diese
malerische Ausstattung wurde aus Kostengründen und mit
Rücksicht auf den fragmentarischen Erhaltungszustand bis auf das
Medaillon des Johannes Evangelista bei der Neugestaltung wieder
übertüncht. Das Figurenprogramm entstand jedoch nicht zur
Erbauungszeit der gotischen Kirche, da sich darunter - über der
Feinputzschichte - eine erste weiße und eine grauweiße
Farbschichte nachweisen ließ. Man wird daher den Kirchenbau um
die Mitte des 15. Jahrhunderts ansetzen dürfen.
Nach
Abnahme der Holzverkleidung im Chor konnten an der nördlichen
Polygonfläche die Reste eines freskierten Medaillons mit der
Halbfigur des Johannes Evangelista entdeckt werden, welches ins
3. Drittel des 15. Jahrhunderts zu datieren ist. Spuren weiterer
Medaillons zeigten sich an der Nordseite des Chores, sodaß
ursprünglich der Hauptaltar an den Wänden von den vier
Evangelistensymbolen umgeben vorzustellen ist. Unterhalb der
Medaillons umzog ein gelbes Vorhangmotiv auf weißem Grund und
zwischen marmorierten Halbsäulen das Presbyterium. Diese
malerische Ausstattung wurde aus Kostengründen und mit
Rücksicht auf den fragmentarischen Erhaltungszustand bis auf das
Medaillon des Johannes Evangelista bei der Neugestaltung wieder
übertüncht. Das Figurenprogramm entstand jedoch nicht zur
Erbauungszeit der gotischen Kirche, da sich darunter - über der
Feinputzschichte - eine erste weiße und eine grauweiße
Farbschichte nachweisen ließ. Man wird daher den Kirchenbau um
die Mitte des 15. Jahrhunderts ansetzen dürfen.
Ebenfalls aus dieser Zeit hat sich im Süden des
Chores die Sakristei erhalten, welche über einem jetzt der
Aufbahrung dienenden Raum errichtet wurde. Beide Baukörper
wurden später verändert.
 Im 17. Jahrhundert
erfolgte die Neueinwölbung des Langhauses mit einer
Stichkappentonne. Schmale Stuckauflagen an den Graten der
Gewölbekappen und die Betonung der Eckverschneidungen durch
kleine, spiralenförmige Motive erlauben eine Datierung in die
Zeit um 1600 11). Schon vorher oder um diese Zeit wurde der Chor
zweimal weiß übertüncht. Nach Angaben in der Pfarrchronik
waren (mit Unterbrechung um 1598) von 1547 bis 1612 im Räume
Attersee evangelische Pfarrer tätig. Bis 1624 befanden sich in
St. Georgen i. A. noch ein Prädikant und ein protestantischer
Schullehrer. Die Umgestaltung des Langhauses und die Fassung des
Chores dürften daher mit Sicherheit auf die Reformationszeit
zurückgehen. Vor allem die erste Übertünchung der Chorfresken
spricht dafür, da das mittelalterliche Dekorationssystem den
liturgischen Vorstellungen der Protestanten widersprach.
Im 17. Jahrhundert
erfolgte die Neueinwölbung des Langhauses mit einer
Stichkappentonne. Schmale Stuckauflagen an den Graten der
Gewölbekappen und die Betonung der Eckverschneidungen durch
kleine, spiralenförmige Motive erlauben eine Datierung in die
Zeit um 1600 11). Schon vorher oder um diese Zeit wurde der Chor
zweimal weiß übertüncht. Nach Angaben in der Pfarrchronik
waren (mit Unterbrechung um 1598) von 1547 bis 1612 im Räume
Attersee evangelische Pfarrer tätig. Bis 1624 befanden sich in
St. Georgen i. A. noch ein Prädikant und ein protestantischer
Schullehrer. Die Umgestaltung des Langhauses und die Fassung des
Chores dürften daher mit Sicherheit auf die Reformationszeit
zurückgehen. Vor allem die erste Übertünchung der Chorfresken
spricht dafür, da das mittelalterliche Dekorationssystem den
liturgischen Vorstellungen der Protestanten widersprach.
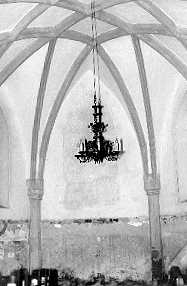 Nach dem vollen Durchbruch der
Gegenreformation um 1633 gehörte St. Martin wieder dem
katholischen Ritus an. Archäologisch konnte im Estrich
des Chores eine durchgehende Ausrißstelle festgestellt
werden, welche von der Fundamentierung des barocken
Hochaltares stammte. Dieser nahm die gesamte Breite des
Polygons ein. Gleichzeitig wurden die Fenster der Kirche
verändert und das Chorscheitelfenster abgemauert. Nach dem vollen Durchbruch der
Gegenreformation um 1633 gehörte St. Martin wieder dem
katholischen Ritus an. Archäologisch konnte im Estrich
des Chores eine durchgehende Ausrißstelle festgestellt
werden, welche von der Fundamentierung des barocken
Hochaltares stammte. Dieser nahm die gesamte Breite des
Polygons ein. Gleichzeitig wurden die Fenster der Kirche
verändert und das Chorscheitelfenster abgemauert.1781
erließ Kaiser Joseph II. das Toleranzpatent, welches im
Attergau den Protestanten die freie Religionsausübung
nach Augsburgischem Bekenntnis zugestand. Damaliges
Zentrum war Zell a. Attersee. 1809 gelangte Attersee
durch den Friedensvertrag von Schönbrunn an Bayern. Die
positive Einstellung der bayerischen Regierung gegenüber
den Protestanten ermöglichte 1813 den Ankauf der seit
Joseph II. aufgelassenen Filialkirche um 400 Gulden. Die
drei noch vorhandenen Altäre der barocken Ausstattung
wurden der evangelischen Gemeinde überlassen 12).
|
 1854 wird der
Westturm angebaut und die Kirchenfront mit zwei
Strebepfeilern verstärkt. Die Bodenpflasterung und
gleichzeitige Bodenanhebung, sowie der Anbau des
Kanzelaltares am Scheitel des Chorpolygons, erfolgten in
den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Spätestens zu
diesem Zeitpunkt entfernte man den mittelalterlichen
Altarsockel, welcher archäologisch nachgewiesen werden
konnte, und errichtete einen schlichten Tischaltar.
Anschließend färbte man den Chor in grauer Farbe. 1854 wird der
Westturm angebaut und die Kirchenfront mit zwei
Strebepfeilern verstärkt. Die Bodenpflasterung und
gleichzeitige Bodenanhebung, sowie der Anbau des
Kanzelaltares am Scheitel des Chorpolygons, erfolgten in
den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Spätestens zu
diesem Zeitpunkt entfernte man den mittelalterlichen
Altarsockel, welcher archäologisch nachgewiesen werden
konnte, und errichtete einen schlichten Tischaltar.
Anschließend färbte man den Chor in grauer Farbe.
1894 stiftete ein Villenbesitzer die
polygonale Gruftkapelle an der Nordseite, und um 1900
stattete die evangelische Gemeinde den Chor mit einem
neugotischen Flügelaltar und einer Seitenkanzel aus. Die
Wände wurden wieder mit einem Vorhangmotiv bemalt,
darüber befanden sich pastellfarbige Rahmenfelder. Die
gotischen Netzrippen erhielten eine Fugenmalerei, die
Gewölbekappen zeigten goldene Sterne auf blauem Grund.
|
Im 20. Jahrhundert wurde der Chor mit
Holzpaneelen verkleidet, die letzte farbliche Fassung war wieder
einheitlich hell mit dunkelgrauer Architekturgliederung. In
jüngster Zeit wurde die neue tiefreichende Orgelempore
eingebaut. Besonders hervorzuheben ist die Neugestaltung des
Chorraumes nach Grabungsabschluß, welche nicht nur einen Teil
der spätgotischen Wandmalerei konservierte, sondern in
lobenswerter Weise durch farbliche Differenzierung des
Presbyteriumbodens die Lage des ergrabenen romanischen
Vorgängerchores dokumentiert. Der jetzige Altartisch befindet
sich an der Stelle des spätmittelalterlichen Altarsockels.
Inhalt | Befunde
Letzte Aktualisierung 22.06.00
 Nach
Abnahme der Holzverkleidung im Chor konnten an der nördlichen
Polygonfläche die Reste eines freskierten Medaillons mit der
Halbfigur des Johannes Evangelista entdeckt werden, welches ins
3. Drittel des 15. Jahrhunderts zu datieren ist. Spuren weiterer
Medaillons zeigten sich an der Nordseite des Chores, sodaß
ursprünglich der Hauptaltar an den Wänden von den vier
Evangelistensymbolen umgeben vorzustellen ist. Unterhalb der
Medaillons umzog ein gelbes Vorhangmotiv auf weißem Grund und
zwischen marmorierten Halbsäulen das Presbyterium. Diese
malerische Ausstattung wurde aus Kostengründen und mit
Rücksicht auf den fragmentarischen Erhaltungszustand bis auf das
Medaillon des Johannes Evangelista bei der Neugestaltung wieder
übertüncht. Das Figurenprogramm entstand jedoch nicht zur
Erbauungszeit der gotischen Kirche, da sich darunter - über der
Feinputzschichte - eine erste weiße und eine grauweiße
Farbschichte nachweisen ließ. Man wird daher den Kirchenbau um
die Mitte des 15. Jahrhunderts ansetzen dürfen.
Nach
Abnahme der Holzverkleidung im Chor konnten an der nördlichen
Polygonfläche die Reste eines freskierten Medaillons mit der
Halbfigur des Johannes Evangelista entdeckt werden, welches ins
3. Drittel des 15. Jahrhunderts zu datieren ist. Spuren weiterer
Medaillons zeigten sich an der Nordseite des Chores, sodaß
ursprünglich der Hauptaltar an den Wänden von den vier
Evangelistensymbolen umgeben vorzustellen ist. Unterhalb der
Medaillons umzog ein gelbes Vorhangmotiv auf weißem Grund und
zwischen marmorierten Halbsäulen das Presbyterium. Diese
malerische Ausstattung wurde aus Kostengründen und mit
Rücksicht auf den fragmentarischen Erhaltungszustand bis auf das
Medaillon des Johannes Evangelista bei der Neugestaltung wieder
übertüncht. Das Figurenprogramm entstand jedoch nicht zur
Erbauungszeit der gotischen Kirche, da sich darunter - über der
Feinputzschichte - eine erste weiße und eine grauweiße
Farbschichte nachweisen ließ. Man wird daher den Kirchenbau um
die Mitte des 15. Jahrhunderts ansetzen dürfen.