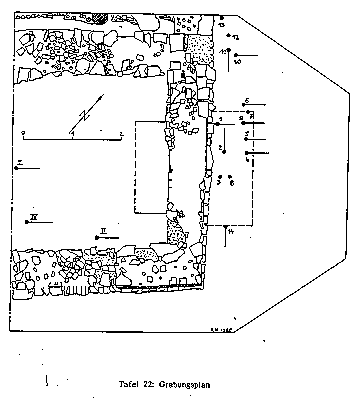 |
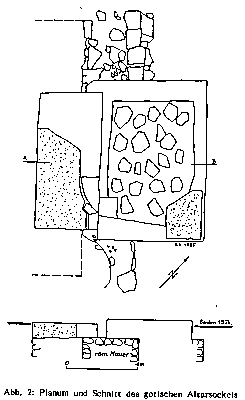 |
Erstpublikation in: Beiträge zur
Mittelalterarchäologie Österreichs 1, 1985, 48 - 57, Taf. 20 -
22.
Ergänzte (Fotos) Online-Version. Bei Zitation Erstpublikation
verwenden.
ARCHÄOLOGISCH-KUNSTHISTORISCHE UNTERSUCHUNGEN IN DER PFARRKIRCHE ST. MARTIN IN ATTERSEE/OBERÖSTERREICH.
Von RUDOLF KOCH. Wien
3. BESCHREIBUNG DER BESTEHENDEN KIRCHE
4. BEFUNDE
4.1. DAS ROMANISCHE CHORQUADRAT (ST. MARTIN I)
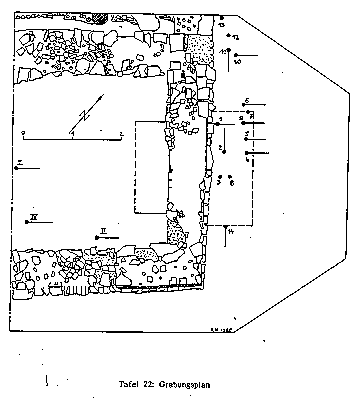 |
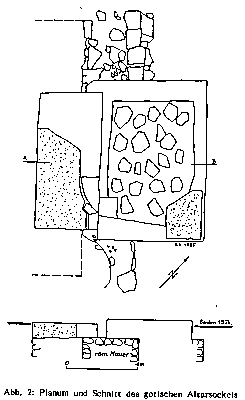 |
Nach Abtragung der Bodenfliesen des 19. Jahrhunderts und der ca. 20 cm hohen Bettungsschicht aus sandigem, leicht mörtelhältigen Boden zeigte sich im Osten des Chorraumes ein fast zur Gänze erhaltener Kalkmörtelestrich. Dieser Estrich ließ sich auch vor der durchgehenden Chorstufe in Resten nachweisen und war mit dem Beginn des gotischen Wandverputzes niveaugleich. Zwei parallele Störungen im gotischen Estrich hinter dem zentralen Altarsockel stammen von der barocken Altarwand.
Unmittelbar unter dem gotischen Estrich beginnt die Bruchstein-Füllmauer des Vorgängerbaus. Sie bildet drei Seiten eines Chorquadrates romanischer Grundrißlösung, welches um ca. 30 cm aus der Achse des gotischen Chores nach Norden verschoben ist. Die lichte Weite des Chorquadrats beträgt rund 3,6 m und nimmt gegen Westen zu, da die Südmauer nicht rechtwinkelig verläuft. Die drei erhaltenen Mauerzüge weisen unterschiedliche Konstruktionsmerkmale auf, wurden jedoch gleichseitig errichtet. Die Fundamente sind im Durchschnitt 90 bis 100 cm, das Aufgehende 80 cm stark.
Die Nordmauer ist ohne Fundamentvorsprung und mit
wenig Sorgfalt gebaut. Die Ostmauer hat einen inneren
Fundamentvorsprung und einen ca. 10 cm tieferliegenden äußeren
Absatz.  Die
Südmauer besitzt nur einen äußeren Fundamentvorsprung, der
gegen Westen von 8 cm auf 20 cm verbreitert wird. Ein Schnitt
durch diese Mauer ergab, daß die Bruchsteinfüllung einheitlich
vom Aufgehenden bis ins Fundament durchlief, die Abweichung von
Aufgehendem und Fundament daher nicht auf eine Zweiphasigkeit
sondern auf Bauunregelmäßigkeiten zurückgeht. Auffallend ist,
daß die Fundamenttiefen des Chorquadrates vom Nordwesten nach
Südosten verhältnismäßig rasch zunehmen und offensichtlich
auf die ursprüngliche Hanglage des Kirchhügels Rücksicht
nehmen.
Die
Südmauer besitzt nur einen äußeren Fundamentvorsprung, der
gegen Westen von 8 cm auf 20 cm verbreitert wird. Ein Schnitt
durch diese Mauer ergab, daß die Bruchsteinfüllung einheitlich
vom Aufgehenden bis ins Fundament durchlief, die Abweichung von
Aufgehendem und Fundament daher nicht auf eine Zweiphasigkeit
sondern auf Bauunregelmäßigkeiten zurückgeht. Auffallend ist,
daß die Fundamenttiefen des Chorquadrates vom Nordwesten nach
Südosten verhältnismäßig rasch zunehmen und offensichtlich
auf die ursprüngliche Hanglage des Kirchhügels Rücksicht
nehmen.
Das Mauerwerk des Chorquadrates zeigt drei Störungen. In der Südmauer wurde bei Errichtung der durchgehenden Chorstufe im 19. Jahrhundert das Aufgehende ausgerissen. In der Südostecke traf man im 16. Jahrhundert beim Ausheben eines Grabschachtes auf die ältere Choranlage und mußte die Mauer teilweise abtragen. Die dritte Störung befindet sich an der Nordost-Außenecke. Diese Ausrißstelle dürfte im Zusammenhang mit der Errichtung des gotischen Chores entstanden sein. Die Fundamente des spätmittelalterlichen Nachfolgebaus reichen hier bis an das romanische Chorquadrat heran.
Für die Datierung des Vorgängerbaus, eine Chorquadratkirche, können nur allgemeine typologische Erwägungen herangezogen werden, da sich keine stratigraphisch verwertbare Keramik fand. Saalkirchen mit Langhaus und Chorquadrat sind ein weit verbreiteter Typus der einfachen romanischen Landkirchen. Sie sind eine Bauform des 12. und 13. Jahrhunderts und zeigen nach KLAAR (1964) 13) in der Hochblüte des romanischen Dorfkirchenbaus im Langhaus ein Seitenverhältnis von l : 2 und im Chor von l : l. In der Frühgotik wird das Chorquadrat in eine gedrungene Rechteckform umgewandelt.
Leider konnten aus grabungstechnischen Gründen der Westteil des Chores und damit der Anschlußstelle zum romanischen Langhaus nicht untersucht werden. In Attersee dürfte die romanische Kirche wegen des relativ großen Chorquadrates nur um weniges kleiner als das jetzige Kirchenschiff gewesen sein. Es ergibt sich somit eine Proportionierung von Chor und Langhaus, welche eine Datierung ins 12. Jahrhundert erlaubt.
Der
romanische Chor hatte an der Außenseite der Südostecke ein
Christophorus-Fresko, welches dem sog. "Weichen Stil"
angehört und in das 1. Viertel des 15. Jahrhunderts zu datieren
ist. Das in ausgezeichnetem Erhaltungszustand überlieferte
Wandgemäldefragment belegt, daß die romanische Kirche noch in
der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts den Anforderungen der
Kirchengemeinde entsprach. Der Neubau könnte durch ein
Naturereignis notwendig geworden sein. Bei den älteren Grabungen
am Kirchhügel wurde nämlich eine Abrutschung des Hanges
festgestellt 14). Dafür sprechen auch die mächtigen Schuttlagen
im Kircheninneren, welche beim gotischen Neubau nicht eingeebnet
wurden. Dadurch bedingt steigt heute der Boden des Langhauses
bühnenartig von Ost nach West an, sodaß der Eingang der Kirche
um rund l m höher als der Chor liegt. Der Höhenunterschied
zwischen dem romanischen Außenniveau - durch den
Fundamentvorsprung am Christophorus-Fresko rekonstruierbar - und
der Eingangsschwelle beträgt sogar 1,74 m.
4.2. DER SPÄTGOTISCHE POLYGONCHOR
Im Verlaufe der Grabung zeigte sich, daß der Polygonchor aus der Mitte des 15. Jahrhunderts nicht in einem Zuge errichtet worden war. Es konnte eine Planänderung in der Bauausführung festgestellt werden.
Das Bodenniveau der gotischen Kirche war demnach zunächst in Höhe des Fundamentvorsprunges geplant. Noch während der Errichtung der Chormauern gab der Boden wegen der darunterliegenden Bestattungen unter dem wachsenden statischen Druck nach, sodaß Sicherungsmaßnahmen und eine Planänderung notwendig wurden. Zu dieser Reparaturphase gehört das Mörtelband zwischen zweiter und dritter Dienstbasis an der Nordseite und eine Erweiterung der Fundamentmauer bis zur Nordostecke des romanischen Chorquadrates. Durch das Höherlegen des Bodenniveaus wurde gleichsam nachträglich eine größere Fundamenttiefe erzielt. Die Dienstbasen mußten um rund 30 cm erhöht werden. |
 Zum Bau des neuen spätgotischen Chores
dürften die Steine des Chorquadrates mitverwendet worden
sein, da sich in den Schuttschichten zwar Mörtelreste
und Teile des Wandverputzes (u. a. gotisches
Christophorusfresko am romanischen Chorquadrat!) fanden,
jedoch keine Bruchsteine. Umso bemerkenswerter war daher
der Fund einer "Apsis aus Trockenmauerwerk" im
Anschluß an das romanische Chorquadrat. Ein Schnitt
durch diese Pseudomauer ergab, daß es sich um die
Aufschüttung aus dem Versturzmaterial der romanischen
Kirche handelte. Die apsidenartige Form bildete sich
zwangsläufig durch den freigebliebenen Raum zwischen
Chorquadrat-Ostmauer, Altarfundament und Polygonmauer des
Neubaus. Diese Steinpackung stellt ebenfalls eine
statistische Verstrebung der Fundamente dar. Zum Bau des neuen spätgotischen Chores
dürften die Steine des Chorquadrates mitverwendet worden
sein, da sich in den Schuttschichten zwar Mörtelreste
und Teile des Wandverputzes (u. a. gotisches
Christophorusfresko am romanischen Chorquadrat!) fanden,
jedoch keine Bruchsteine. Umso bemerkenswerter war daher
der Fund einer "Apsis aus Trockenmauerwerk" im
Anschluß an das romanische Chorquadrat. Ein Schnitt
durch diese Pseudomauer ergab, daß es sich um die
Aufschüttung aus dem Versturzmaterial der romanischen
Kirche handelte. Die apsidenartige Form bildete sich
zwangsläufig durch den freigebliebenen Raum zwischen
Chorquadrat-Ostmauer, Altarfundament und Polygonmauer des
Neubaus. Diese Steinpackung stellt ebenfalls eine
statistische Verstrebung der Fundamente dar. |
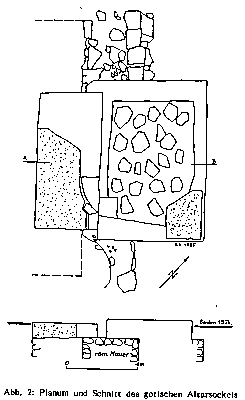 Die
Fundumstände des Altarsockels lassen eine Rekonstruktion des
gotischen Altares zu. Zunächst muß bemerkt werden, daß die
Ostmauer des Chorquadrates an der Oberfläche im Gegensatz zu den
Längsmauern sorgfältig mit Mörtel abgestrichen ist. Im Osten
schließt der Fundamentsockel des Altares an. Über der Ostmauer
und diesem Sockel wurde der eigentliche Altarfuß, der Stipes,
errichtet. Um den Stipes verläuft eine etwa 20 cm breite Fuge,
welche im Mörtelbett noch deutlich die Standspuren von
Steinplatten zeigt. Im Westen, vor dem Altarfuß, lagert eine
mächtige, rechteckige Schieferplatte, die an der Nordseite
schräg abgebrochen ist und durch eine Kalkmörtelplatte ergänzt
wird. Eine kleinere Schieferplatte liegt an der Südostecke des
Altarsockels und unterbricht die umlaufende Fuge des Altarfußes.
Ebenso ist ein Teil der Trennfuge zwischen dem Vorderteil des
Altares mit der großen Schieferplatte und dem Stipes vermauert.
Die
Fundumstände des Altarsockels lassen eine Rekonstruktion des
gotischen Altares zu. Zunächst muß bemerkt werden, daß die
Ostmauer des Chorquadrates an der Oberfläche im Gegensatz zu den
Längsmauern sorgfältig mit Mörtel abgestrichen ist. Im Osten
schließt der Fundamentsockel des Altares an. Über der Ostmauer
und diesem Sockel wurde der eigentliche Altarfuß, der Stipes,
errichtet. Um den Stipes verläuft eine etwa 20 cm breite Fuge,
welche im Mörtelbett noch deutlich die Standspuren von
Steinplatten zeigt. Im Westen, vor dem Altarfuß, lagert eine
mächtige, rechteckige Schieferplatte, die an der Nordseite
schräg abgebrochen ist und durch eine Kalkmörtelplatte ergänzt
wird. Eine kleinere Schieferplatte liegt an der Südostecke des
Altarsockels und unterbricht die umlaufende Fuge des Altarfußes.
Ebenso ist ein Teil der Trennfuge zwischen dem Vorderteil des
Altares mit der großen Schieferplatte und dem Stipes vermauert.
Aus diesen Abmauerungen und den Baufugen lassen sich zwei Umbauphasen des Altares ableiten:
1. Der älteste Teil aus der Erbauungszeit der gotischen Kirche war ein Blockaltar, der in der Art eines Kastenaltares durch senkrechte Platten umgestellt wurde 15).
2. Noch im Mittelalter dürfte die Schieferplatte als Stufe vor den Altar gelegt worden sein. Diese Erweiterung könnte im Zuge der Neuausstattung des Chores mit den Fresken im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts geschehen sein.
3. Als spätere, zweite Umbauphase ist die Abmauerung der Trennfuge zwischen Stufe und Altar und der Einbau der rückwärtigen Schieferplatte erfolgt. Die Schieferplatte zeigt bei geringerer Dicke die gleiche schräge Bruchstelle wie die der vorderen Stufe, welche jetzt durch Mörtel ergänzt ist. Aus diesem Umbau wird ersichtlich, daß nun keine senkrechten Kastenplatten mehr vorhanden sind, der Altarstipes demnach zerstört und entweiht worden war. Eine Datierung kann nur indirekt erschlossen werden.
In der Regel konnten die protestantischen Gemeinden den Hochaltar weiterverwenden. Lediglich das Altarpatrozinium und die Aufbauten mußten geändert werden. Die Gegenreformation trachtete, durch die aufwendige Kunst des Barock der neuen, dogmatischen Verherrlichung Gottes Ausdruck zu verleihen. In Attersee dürfte daher der durch die Protestanten ohnedies entweihte gotische Altaraufbau um 1633 abgetragen und durch einen barocken Holzaltar mit dahinterliegendem Querbau ersetzt worden sein.
Letzte Aktualisierung 22.06.00