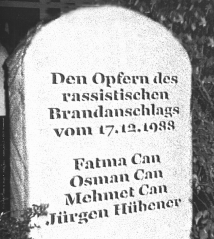| Rede 1 Liebe Unerwünschte,
zu den Gründen für unsere alljährliche Demonstration ist ein weiterer
hinzugekommen. Der Schwandorfer Stadtrat hat am 2. März dieses Jahres beschlossen: Ein
Mahnmal für die Opfer des Brandanschlags vom 17.12.1988 wird nicht errichtet. Und das
obwohl es billiger nicht ging: Kein Dokumentationszentrum haben wir gefordert, keine
Informationstafeln, nur einen schlichten Stein mit den Namen der Opfer. Einen schlichten
Stein, den wir sogar selber finanziert haben. Ja wir hätten sogar die Kosten für die
feste Aufstellung selber getragen. – Doch die Verantwortlichen haben höherstehende
Gründe, warum sie den Stein ablehnen. Es geht ihnen nicht um den schnöden Mammon. Es
geht ihnen auch nicht um den Platzbedarf, nämlich 1 Quadratmeter, für den Stein. Der
Platz ist da, trotz Telefonzelle. Die Botschaft, die dieser Stein vermittelt, passt ihnen
nicht. Die Botschaft steht nicht auf dem Stein, der Stein erinnert nur an das Verbrechen
und an die Opfer. Die Botschaft, die der CSU und einigen anderen nicht passt, lautet:
"Vergesst nicht, was hier – mitten in unserer schönen Stadt – passiert
ist, es könnte wieder geschehen." Das ist die Botschaft der Opfer, Fatma Can. Mehmet
Can, Osman Can und Jürgen Hübener, die sterben mussten, weil niemand die Gefahr gesehen
hat – oder sehen wollte.
Auch heute will niemand die rechte Gefahr sehen. Das jedenfalls ist die
Botschaft, die von der CSU-Mehrheit im Stadtrat ausgeht. Da wird so getan, als sei dieser
Brandanschlag der Normalzustand, ein Gewaltverbrechen wie jedes andere auch – quasi
ein Betriebsunfall, mit dem man rechnen muss, gegen den man nichts tun kann. Da ist es nur
konsequent, dass die CSU nicht viel vom Gedenken hält. – Doch wir können etwas tun,
wir müssen etwas tun gegen rechte Gewalt.
Wir müssen wachsam sein. Wer hätte im November 1988 für möglich
gehalten, was am 17. Dezember dann geschah? – Die wenigsten. – Uns erinnern
heisst: Bei der Vergangenheit nicht wegschauen und in der Gegenwart hinschauen.
Doch wer schaut heute hin? Bestenfalls die Polizei, wenn es mal wieder zu spät ist. Wir
alle müssen hinschauen, und nicht erst dann, wenn es zu spät ist.
Am 26. November 1988 – drei Wochen vor der Tat – wurde der
Schwandorfer Brandstifter im Münchner Olympiastadion festgenommen, weil er "Sieg
Heil" gerufen hatte. – Anfang März dieses Jahres riefen Rechtsextreme in
Teublitz "Heil Hitler". Erst als sie mit ihrem Geschrei eine Ausschusssitzung im
Rathaus störten, wurde die Polizei gerufen.
Was weiss OB Hans Kraus über Rechtsextremismus in Schwandorf? Er
schreibt am 23. Februar dieses Jahres: "In der Zeit seit 01.01.1988 wurden bei den
zuständigen Polizeidienststellen 16 Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund
erfaßt. Nach Auskunft der Polizeidirektion Amberg konnten bei 12 Taten insgesamt 14
Beschuldigte bzw. Verdächtige ermittelt werden. Um welchen Personenkreis es sich dabei
handelt, entzieht sich meiner Kenntnis."
Mehr zu den rechten Umtrieben hier im Umkreis in der nächsten Rede.
Liebe Unerwünschte,
In Solingen, jener Stadt in der am 29. Mai 1993 fünf türkische
Menschen einem Brandanschlag zum Opfer fielen, gibt es jährliche Gedenkveranstaltungen,
an denen auch der dortige Oberbürgermeister teilnimmt. Seit knapp zwei Jahren gibt es
dort – und der Standort wurde bewusst gewählt – auch ein Landeszentrum für
Zuwanderung. Daneben gibt es Initiativen wie SOS Rassismus oder die "AG Weisse
Rose", eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern am dortigen
Geschwister-Scholl-Gymnasium, die sich gegen Gewalt und Rassismus engagieren.
Ist so etwas in Schwandorf undenkbar? Nein, wir können etwas tun, wir
müssen etwas tun gegen rechte Gewalt.
Liebe Unerwünschte,
Ein Mahnmal wird nach dem Willen des Stadtrats nicht errichtet. Wie
steht es ansonsten mit dem Erinnern in dieser Stadt?
Schauen wir uns einmal an, wie die Stadt der Opfer von Todesmärschen
gedenkt, also derjenigen KZ-Häftlinge, die in den letzten Tagen der Naziherrschaft durchs
Land getrieben wurden, auch durch Schwandorfer Stadtgebiet, und dabei starben. – Was
tut die Stadt? – Sie schweigt.
Was tut die Stadt am 09. November, dem Jahrestag der Reichsprogromnacht,
in der auch hier in Schwandorf die Nazis wüteten? – Sie schweigt.
Was tut die Stadt am 08. Mai, dem Jahrestag der Befreiung durch
amerikanische Truppen? – Sie schweigt.
Was tut die Stadt am 17. April, dem Jahrestag des grossen Bombenangriffs
auf Schwandorf im Jahre 1945? – Der Oberbürgermeister gibt einen Aufruf heraus.
Darin spricht er von der "schrecklichsten Stunde in der gesamten Geschichte der
Stadt" Und weiter heisst es in dem Aufruf: "Wir wollen und dürfen auch nach 54
Jahren die Opfer dieser Nacht nicht vergessen. Diese Nacht der Zerstörung muß uns immer
in Erinnerung bleiben, heute und in der Zukunft."
Was tut die Stadt, um die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege zu
ehren? – Sie pflegt 11 Kriegerdenkmäler.
Liebe Unerwünschte,
das sind also die Gewaltopfer, derer die Stadt gedenkt. Zivilistinnen
und Wehrmachtsangehörige, die im verbrecherischen Krieg der Nazis ums Leben kamen. Dass
viele der Opfer in Wirklichkeit Täter waren, verschweigt die regierende CSU mit immer
unverhohlener werdender Zustimmung der Ewiggestrigen.
Wo ist sie, die Distanzierung von den Tätern? Hören wir dazu den OB,
ich zitiere: "Vertreter der Stadt bringen diese Haltung gegen den Nationalsozialismus
alljährlich durch zentrale Gedenkveranstaltungen am Volkstrauertag auch zum Ausdruck.
Darüber hinaus gehender Veranstaltungen bedarf es nach überwiegender Meinung des
Stadtrates nicht." Konkret heisst das dann, dass ein Kranz niedergelegt wird, ein
wahrhaft interpretierbares Ritual.
Liebe Unerwünschte,
Am 14. Februar 1994 schrieb der Schwandorfer Oberbürgermeister:
"Die unbegreifliche Tat und die Toten werden den Schwandorfern in Erinnerung bleiben,
eines Mahnmals bedarf es dafür nicht." – Wären wir heute nicht hier, die
Schwandorfer würden sich also erinnern und alle anderen wüßten von nichts. Aber woran
würden sich die Schwandorfer erinnern? An ein brennendes Haus, an verbrannte
Menschen, an Ausländer, vielleicht auch an die Opfer. Aber sicher an das Feuer.
Verbrennen ist vielleicht die qualvollste Art zu sterben. Diese Art zu töten hat
Tradition: Scheiterhaufen, Reichspogromnacht, KZ-Krematorien. Dem Feuer wird in dieser
Tradition eine reinigende Kraft zugeschrieben – Vernichtungskraft. Beliebt war das
Feuer vor allem wegen seiner Signalwirkung, z.B. beim Reichstagsbrand oder bei den
Bücherverbrennungen. Beliebt ist das Feuer auch in heutiger Zeit bei denen, die
Unterkünfte von AsylbewerberInnen anzünden, und nicht zufällig aus denselben Gründen.
Die Signalwirkung, die von Rostock-Lichtenhagen, von Moelln, von Solingen ausging,
wurde zurecht als Flächenbrand verstanden, und es gab ein kurze Zeit gesellschaftlicher
Empörung, paradoxerweise mit kleinen Flammen, sogenannten Lichterketten. Das Feuer
ist hell, warm, lebendig und zieht den Blick von Menschen magisch in seinen Bann. Sie
stehen schweigend davor und schauen zu. Es schafft eine heimelige, gemeinschaftliche
Atmosphäre, am 09. November 1938 sogar eine volksgemeinschaftliche.
Ein Feuer ist leicht gelegt. Der heimliche Brandstifter muss sich nicht
bekennen, das Feuer spricht statt seiner. Alle kennen die Botschaft, doch einer
unausgesprochenen Botschaft lässt sich nicht widersprechen. Scheinbar sind alle verdammt
zum Schweigen und Zuschauen. Immer wieder haben wir das bei Brandstiftungen in den
vergangenen Jahren erleben müssen: "Die Polizei hat keine Hinweise auf einen
rechtsextremen Hintergrund", heisst es dann in der Presse. Vom hiesigen Brandanschlag
wissen wir aber: Das Motiv war eindeutig Ausländerfeindlichkeit.
Heim–tückisch nahm der Schwandorfer Attentäter am Abend des 17.
Dezember 1988 – Weihnachtszeit, wie jetzt – eine Schachtel Zündhölzer von zu
Hause mit. Keine Weihnachtskerzen wollte er damit anzünden. Menschen. Drei Zündhölzer
reichten für das heim–liche Feuer, das er legte. Das Signal, das er setzte, –
in grausamster deutscher Tradition –, ist vielen in Erinnerung. —— Nicht in
Erinnerung ist, dass es gesellschaftlichen Widerstand gegen solche Feuer gibt.
Ein Symbol dieses Widerstands, verbunden mit einem Bekenntnis einer
breiten Mehrheit dieser Stadt, fehlt bis heute skandalös.
Das Motiv des Täters, der wegen Brandstiftung und nicht wegen Mordes
verurteilt wurde, war Ausländerfeindlichkeit. Ausländerfeindlichkeit wurde und wird
gesellschaftlich erzeugt. Inzwischen ist ein Teil der Rassisten vom heimlichen Mordbrennen
übergegangen zum Zusammenschlagen auf offener Strasse. Umso wichtiger ist eine eindeutige
gesellschaftliche Ächtung und tatkräftige Verhinderung dieser Anschläge geworden.
Schweigen gibt den Tätern recht, eine Verharmlosung gar leistet ihnen Vorschub.
Liebe Unerwünschte,
wir müssen uns fragen, ob alle, die scheinbar nichts gelernt haben,
wirklich nichts gelernt haben aus der Vergangenheit, oder ob sie nun dasselbe wie vorher,
nur auf andere Weise versuchen.
Liebe Unerwünschte,
es wäre naiv zu glauben, dass wir an der rechten Gewalt etwas ändern
können, ohne die gesellschaftlichen und zumal politischen Ursachen zu bekämpfen. Meine
NachrednerInnen werden solche Ursachen und Zusammenhänge aufzeigen.
Wir können etwas tun, wir müssen etwas tun gegen rechte Gewalt. Dazu
ist der erste und kleinste Schritt, dass die Stadt und an ihrer Spitze der OB sich gegen
Rechtsextreme aussprechen, klar und deutlich, zumindest aber mit einem winzigen Symbol,
wie es hier vor uns steht [Hinweis auf Stein].
Liebe Unerwünschte,
Rechte Gewalt ist kein vorübergehendes Phänomen und Schwandorf ist
kein Einzelfall. Die Gewalt hat hier eine vorher nicht gekannte, schreckliche Dimension
erreicht. Deshalb muss von Schwandorf ein Signal ausgehen. Wir können etwas tun, wir
müssen etwas tun gegen rechte Gewalt.
Am 19. April 1945, 8 Tage nach der Selbstbefreiung des KZ-Buchenwald
haben die Überlebenden auf dem dortigen Appellplatz einen Schwur abgelegt, in dem von
zweierlei Schuld die Rede ist. Es ist der bekannte Schwur von Buchenwald, mit dem ich
schliessen möchte: "Wir schwören deshalb vor aller Welt auf diesem Appellplatz,
an dieser Stätte des faschistischen Grauens: Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch
der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht! Die Vernichtung des Nazismus mit
seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der
Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen
schuldig." |