ARCHÄOLOGISCH-KUNSTHISTORISCHE UNTERSUCHUNGEN IN DER PFARRKIRCHE ST. MARTIN IN ATTERSEE/OBERÖSTERREICH.
Von RUDOLF KOCH. Wien
3. BESCHREIBUNG DER BESTEHENDEN KIRCHE
4.1. DAS ROMANISCHE CHORQUADRAT (ST. MARTIN I)
4.2. DER SPÄTGOTISCHE POLYGONCHOR
5.1. DAS CHRISTOPHORUS-FRESKO DES "WEICHEN STILS"
 Das bis zum Fundamentvorsprung des
Chorquadrates reichende Wandgemälde zeigt von West nach
Ost das Ende des Christophorus-Stabes, drei Zehen des
rechten Fußes und einen schlanken Fischleib.
Ikonographisch läßt sich daraus eine
Christophorus-Gestalt ableiten, welche sich in
Schreitstellung nach Osten wendet und den Stab in ihrer
Rechten hält. Aus den oft nur zentimetergroßen
Verputzstücken konnte der Christuskopf und ein Teil der
"herzoghutartigen" Kopfbedeckung mit
Hermelinbesatz des Riesen zusammengesetzt werden 16). Die
rekonstruierbare Größe des Riesen beträgt ca. 3 bis 4
m. Das Fresko wurde in zwei Phasen ausgeführt. Über dem
Grobputz brachte man in Rot die Vorzeichnung bzw. Sinopia
auf, dann wurde der Verputz teilweise angespitzt und der
endgültige Feinputz aufgetragen Das bis zum Fundamentvorsprung des
Chorquadrates reichende Wandgemälde zeigt von West nach
Ost das Ende des Christophorus-Stabes, drei Zehen des
rechten Fußes und einen schlanken Fischleib.
Ikonographisch läßt sich daraus eine
Christophorus-Gestalt ableiten, welche sich in
Schreitstellung nach Osten wendet und den Stab in ihrer
Rechten hält. Aus den oft nur zentimetergroßen
Verputzstücken konnte der Christuskopf und ein Teil der
"herzoghutartigen" Kopfbedeckung mit
Hermelinbesatz des Riesen zusammengesetzt werden 16). Die
rekonstruierbare Größe des Riesen beträgt ca. 3 bis 4
m. Das Fresko wurde in zwei Phasen ausgeführt. Über dem
Grobputz brachte man in Rot die Vorzeichnung bzw. Sinopia
auf, dann wurde der Verputz teilweise angespitzt und der
endgültige Feinputz aufgetragen |
.Allgemein kann zur Bedeutung der Christophorus-Darstellungen gesagt werden, daß der Christusträger im Spätmittelalter zu den am häufigsten an Kirchen dargestellten Heiligen gehört. Sein Anblick sollte vor plötzlichem Tod schützen 17). In Attersee besticht besonders die prädestinierte Lage des Freskos zum See hin. Die Darstellung muß einst von imposanter Signalwirkung für die vorbeifahrenden Fischerboote gewesen sein.
5.2. DER RENAISSANCE-BUCHEINBAND
In der Südostecke des Chorquadrates lag hart an der Mauer ein Grabschacht mit der Bestattung eines 35 bis 40jährigen Mannes in einem Holzsarg (Grab II) 18). Es fanden sich noch die Verfärbungen des knielangen Mantels, der Handschuhe und der Lederschuhe. In der rechten Hand der über der Brust gekreuzten Arme hielt der Tote einen ca. 8 x 13 cm großen Ledereinband mit Eckbeschlägen, vermutlich ein Gebetbuch. |
Auf der Hüfte lag eine runde Tasche mit metallenem Öffnungsbügel, die im Inneren u. a. einen doppelseitigen Kamm und eine etwa briefmarkengroße Klappsonnenuhr aus Bein barg. |
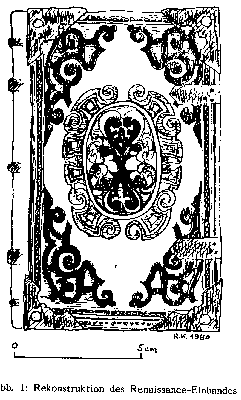 |
Ledereinband während der Bergung Der Ledereinband kann zur genaueren Datierung herangezogen werden 19). Er zeigt an der Vorder- und Rückseite das gleiche Muster und ist an den Ecken mit Metallwinkeln verstärkt. Zwei zungenförmige Metallschließen halten ihn zusammen, der Rücken besaß vier bis fünf Bünde. Im Inneren konnten noch die Reste von Papierseiten festgestellt werden. |
Die Mitte des Einbandes wird von einer ovalen Rollwerkkartusche eingenommen, welche von einem floralen Motiv gefüllt wird. Die Kartusche ist im vergoldeten Blinddruck ausgeführt, das Mittelmotiv weiß bemalt. Die verbleibende Fläche innerhalb der Kartusche zeigt ein schraffiertes Arabeskenmuster in Goldauflage. Die Ecken des Deckels ziert weiß bemaltes Bandwerk, das durch Goldschraffur hinterlegt wird. Diese Dreieckfüllungen rahmt ein vergoldetes Perlschnurmotiv.
Die flächige Durchbildung der Renaissancemuster findet sich vor allem auf deutschen Bucheinbänden ab der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die Details machen eine Datierung ins 4. Viertel des 16. Jahrhunderts wahrscheinlich. Ein Einband in Augsburg gibt nahezu die gleichen Eckbeschläge wieder wie das Atterseer Exemplar. Der Augsburger Einband wird um 1600 datiert, seine Ecken dürften etwas älter sein 20).
Die Bestattung erfolgte demnach noch in der Reformationszeit. Die Lage unmittelbar rechts vom Hochaltar und die Beigaben des Toten lassen auf eine sozial höherstehende Person mit humanistischer Bildung schließen. Wahrscheinlich handelt es sich um einen protestantischen Geistlichen. Durch die Grabbeigaben unterscheidet sich der Tote von den übrigen Bestatteten, der anthropologische Befund weist ihn ebenfalls als nicht zur ansässigen Bevölkerung gehörig aus.
Letzte Aktualisierung 22.06.00