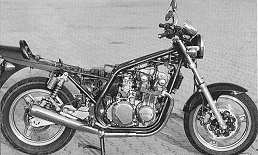|
|
Vergleichstest Zephyr
750 gegen Z 650
IM LAUFE DER ZEIT
( aus PS 3/1991 )

Die handliche, durchzugsstarke
Kawasaki Z 650 von 1976
ist die Basis der neuen
Zephyr 750.
Kann dieses Konzept heute
noch überzeugen ?
Es gibt Motorräder,
die Dich einfach fesseln. Sie reißen mit, ihre Formen
prägen sich ein, und Du träumst von ihnen. Später,
wenn es sie nicht mehr gibt, erzählst Du Legenden über
sie und wünschst ihre Wiederkehr. Wenn sie dann eines
Tages doch wieder vor Dir stehen, als brandneue Modelle
sogar, bist Du elektrisiert und fängst wieder an zu
träumen.
Wie auf der IFMA
im Herbst 1990, als Du auf dem Kawasaki-Stand beim Anblick
der neuen Zephyr 750 glaubst, wieder die Z 900
vor Dir zu haben. Wie ein Blitz trifft Dich die Erinnerung.
Diese Formen kennst Du doch. Fast alles stimmt, aber war
sie damals nicht viel größer ? |
Aber
halt, da gab es doch noch eine kleine 650er, die wieselflink
durch die Kurven streifte und ihren Fahrer niemals so überforderte
wie die 900er. Hat Kawasaki die beiden etwa vereint, neu
ausgestattet und damit das Traummotorrad von einst verwirklicht
?
Um dies zu erfahren, haben wir eine Z 650 von 1978 herangezogen
und die neue 750er mit ihr auf Testfahrt geschickt.
Die modernisierte
Technik wurde geschickt in dem alten Kleid verpackt.
Der Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen
täuscht vor, mit dem alten Gestell völlig baugleich
zu sein. |

Wie Geschwister:
Die Linienführung zeigt die Verwandtschaft zwischen
der Zephyr (links)
und der
Z 650
|
Erst wenn Tank,
Sitzbank und Seitendeckel demontiert sind und ein genauer
Blick die Rohrführung streift, wird deutlich. daß
es neu gezeichnet wurde. Die Rohre sind massiver als früher,
sie umlaufen den Motor wie ein Käfig, und die beiden
Schleifen des Rahmenrückgrats setzen nicht mehr am
unteren, sondern am oberen Ende des Lenkkopfs an. Sie sind
durch Dreiecksverbände und Knotenbleche mit dem unteren
Ende verbunden. So ist der Lenkkopf in einen Verbund von
sechs Rohren eingebettet. Das Vorderrad wird nun von einer
Gabel mit modernen 41 Millimeter Standrohrdurchmesser geführt.
Hinten übernimmt eine massige Leichtmetall-Kastenschwinge
mit Exzenter für die Kettenspannung die Radführung,
die Feder- und Dämpfungsarbeit teilen sich aber ganz
konservativ zwei seitliche Federbeine. |
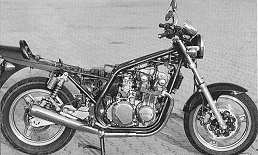
Der Rahmen
der Zephyr 750 ist wesentlich
massiver,
der Motor trägt die Stilelemente
von der
900er
|

Speichenräder,
schmale Reifen, hinten Trommelbremse, zusätzlicher
Kickstarter
bei der
Z 650
|
|
Das Motorrad
rollt auf 17- Zoll-Rädern, vorn mit drei Zoll, hinten
mit vier Zoll breiten Felgen und Reifen im neuzeitlichen Niederquerschnitt-Format:
120/70-17 vorn, 150/70- 17 hinten.
Für die Verzögerung
sorgen vorn zwei gelochte, schwimmend gelagerte Gußscheiben
mit 300 Millimetern Durchmesser, die von Doppelkolben-Schwimmsätteln
mit unterschiedlich großen Radbremszylindem umfaßt
werden. Hinten nehmen gleiche Sättel eine 230er Scheibe
in die Zange. Soweit die auffälligsten Neuerungen.
Die
Liebe steckt im Detail des Nostalgikers. Auf den fast unverändert
von der alten Z 750 – einer Weiterentwicklung der Z 650 aus
dem Jahr 1982 – übernommenen Motor wurden die wie Schnekkenhäuser
geschwungenen Ventildeckel der Z 900 aufgesetzt und auch deren
rundlichere Kühlrippen gewählt. Der Motor ist vornehm
graublau lackiert, mit herrlich polierten Seitendeckeln. Vor
ihm ist ein formschöner Ölkühler montiert,
der das Schmiermittel nicht etwa durch schnöde Schläuche,
sondern durch verchromte Leitungen zugeführt bekommt.
Die zwei Uhrenschalen haben die Form, die schon früher
den Blick des Fahrers von der Strasse locken konnte. Noch
dazu sind sie voll verchromt, wie auch die Spiegel und die
tropfentörmig gestylten Blinker. Zierliche Leichtmetall-
Fussrasten, dazu ein eng verlegter Auspuff mit zwei dünnen
Enddämpfern lassen die Maschine schlank wirken. Wer von
der alten 650er umsteigt, auf der die tief und vorn angebrachten
Fussrasten und der relativ hohe und breite Lenker eine aufrechte
Sitzposition erlaubt, dem fällt sofort auf, daß
es bei der neuen kompakter und sportlicher zugeht. Aber die
Sitzhaltung ist bequem, alles liegt ergonomisch günstig. |
Der Anlasser
erweckt dann das altbekannte Aggregat zum Leben. Wie schon
in früheren Tagen, als der Motor noch in den alten Modellen
seinen Dienst verrichtete, legt er nach wie vor unwillige
Kaltlaufeigenschaften an den Tag. Der Choke sitzt aber nun
nicht mehr am Vergaser, sondern in der Schaltereinheit der
linken Lenkerarmatur und ist leicht mit dem Daumen zu bedienen.
Wenn
der Zephyr-Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat, wird
er zum Erlebnis allererster Klasse. Wie der alte 650er kann
er ab 3000 Touren im fünften Gang bewegt werden, nur
dreht er noch 1000 Umdrehungen weiter, bis 10 000/min. |
Ausserdem reagiert
er über die modernen Gleichdruck-Flachschiebervergaser
doch wesentlich spontaner auf die kleinste Bewegung des
Gasgriffs. In dem gesamten nutzbaren Drehzahlbereich legt
er völlig gleichmässig zu. Setzte der alte Motor
durch seinen voll gleitgelagerten Kurbeltrieb zu seiner
Zeit Masstäbe in Sachen Laufruhe, wirkt er gegen seinen
neuesten Ableger wie ein Rauhbein. Dies liegt wohl nicht
zuletzt an der Silentblocklagerung im neuen Fahrgestell,
während der Motor irn alten noch starr verschraubt
war.
Ihrer um fünfzehn Jahre älteren Schwester zieht
die Zephyr in allen Bereichen davon, obwohl die 650er auch
nur sechs Pferde weniger hat. Leider konsumiert das neue
Motorrad aber geringfügig mehr Benzin als das alte.
Wie bei der Z 650, ist auch bei der Zephyr die Gesamtübersetzung
sehr kurz, was zusammen mit der sehr gelungenen Motor-Abstimmung
für schaltfaules, zügiges Fahren sorgt. Die Gänge
rasten mit kurzen Schaltwegen weich und sicher ein,wesentlich
besser als bei der alten.
Das Fahrwerk
der Z 650 war seinerzeit vielleicht das beste, was die Japaner
auf öffentliche Strassen brachten. Es ließ sich
bis Höchstgeschwindigkeit sicher fahren, war trotzdem
ausgesprochen handlich und beutelte nicht mit gnadenloser
Härte. Heute gelten andere Maßstäbe. |

Auf der Z650
sitzt der
Fahrer auch
bei zügiger
Fahrweise
klassisch
aufrecht |
|
 Die Zephyr
erlaubt
Die Zephyr
erlaubt
dynamische
Fahrweise,
die Bodenfreiheit
reicht aus
|
Der Geradeauslauf
ist kein Thema mehr, das muß jeder Hersteller beherrschen.
Handlichkeit ist gefragt. 17 Zoli ist heute das Standardmaß
der Räder, da darf auch die Zephyr keine Ausnahme machen.
Und sie enttäuscht nicht. Sie lässt sich wesentlich
leichter umlegen als die 650er, wirkt aber zunächst etwas
nervös. Nach wenigen Kilometern Eingewöhnung fühlt
sich der Fahrer aber pudelwohl. Dann eilt die Fuhre wie an
der Schnur gezogen durch jede Biegung. Bis Höchstgeschwindigkeit
kann sie sowohl solo als auch zu zweit so gut wie nichts aus
der Ruhe bringen.
Bis
etwa 170 km/h ist die alte auch für heutige Verhältnisse
ein Musterbeispiel an Zielgenauigkeit und liegt wie ein Brett.
Darüber kommt eine leichte Unruhe im Lenkkopfbereich
auf, aber sie schaukelt sich keineswegs auf. Weder Längs-
noch Querrillen können ihr etwas anhaben, und provozierte
Lenkerunruhe klingt sofort ab. Dieses Phänomen mag an
dem hohen und breiten Lenker liegen, der den Fahrer bei Höchstgeschwindigkeit
zu einem Dauerklimmzug zwingt. Schnelles Fahren ist auf der
Zephyr durch die kompaktere Sitzhaltung wesentlich angenehmer. |
Es gibt aber
eine Übung, die die alte Kawasaki besser kann. Durch
den breiteren Vorderreifen und dem kleineren Raddurchmesser
neigt die
Zephyr bei plötzlichem
Bremsen der Kurve zum Aufstellen. Das ist der 650er völlig
fremd. Dafür gehören die neuen Bremsen zum Feinsten.
Der Druckpunkt ist eindeutig zu spüren, die Kraft von
zwei Fingern reicht völlig, und die Bremswirkung ist
vehement. Zu allem Luxus lässt sich die Hebeleinstellung
per Exzenter wie auch am Kupplungshebel vierfach verstellen.
Vor fünfzehn Jahren mußte die Bremshand noch fest
zupacken und erzielte trotzdem weniger Wirkung. Hier ist die
deutlichste Entwicklungsleistung der Ingenieure zu bemerken.
Die hintere Bremsanlage arbeitet bei beiden Maschinen gut
dosierbar und ohne das Hinterrad zum Stempeln zu zwingen. |
Die massige
Kastenschwinge
und die neuen
Federbeine
sorgen bei der
Zephyr für
saubere Radführung
 |

Die vordere
Bremsanlage
mit 300 mm
Scheiben
verzögert
die
Zephyr
vorbildlich |
Bei den Federelementen
haben die Ingenieure ebenfalls viel dazugelernt. Wer Bedenken
gegenüber der Leistungsfähigkeit der zwei einzelnen
Federbeine hatte, weil doch heute ein Zentralfederbein modern
ist, verliert sie nach der ersten Probefahrt. Die aufwendigen
Kayaba-Elemente lassen sich in der Federbasis fünffach,
in Druck- und Zugstufe je vierfach verstellen. Und zwar sehr
eftektiv. Wir haben im Solobetrieb je nach Fahrergewicht mit
der Federstellung zwei bis drei, Zugstufe eins bis zwei, Druckstufe
eins das beste Fahrverhalten erzielt. Im Zweimannbetrieb sollte
die Federbasis auf maximaler Höhe stehen, die Zugstufe
auf drei und die Druckstufe auf vier. An der 650er lässt
sich nur die Federbasis verstellen. Für den Solobetrieb
reicht die Dämpfung noch aus, im Zweimannbetrieb – für
den sich beide Maschinen in punkto Platzangebot gut eignen
– ist sie aber völlig überfordert. Die Maschine
wippt, und die Federung schlägt durch.
Die
Gabel der Zephyr mit ihren 41 Millimeter starken Standrohren
ist nicht verstellbar. Zwar ist sie verwindungssteifer als
die alte 36er und spricht wesentlich sensibler an, dazu ist
sie in der Zugstufe besser gedämpft, aber die Federrate
ist eindeutig zu weich gewählt. Bereits im Solobetrieb
und bei winterlichen Temperaturen schlägt sie beim harten
Bremsen durch. |
|
Der Vergleich
zeigt, daß ein 15 Jahre altes Konzept mit diversen technischen
Neuerungen auch heute noch überzeugen kann. Aber paßt
die Zephyr überhaupt in unsere Zeit, in der Motorräder
mit gleichem Hubraum heutzutage volle 100 PS leisten und hinter
deren Verkleidung selbst Tempo 200 und mehr ein Kinderspiel
ist ? Eindeutig
ja. Sie ist eine Fahrmaschine, die im Alltag in fast allen
Belangen rundum überzeugt, und daß
zu einem sehr günstigen Preis.
Viele hatten geglaubt,
das Universalmotorrad sei tot, aber die Zephyr zeigt, daß
dies ein Irrtum war. Auf der Landstrasse erfreut sich der
Zephyr-Pilot eines erwachsenen Motorrades, das dank der überzeugenten
Durchzugskraft des Motors und der Fahrwerksqualitäten
wie einst die Z 650 die klotzigen PS-Monster verblüffen
kann.
In Japan
versprechen sich die Marktstrategen einiges von der nackten
Schönheit. Dort gibt es als Zubehör Tank und Sitzbank
in original Z 900-Form und –Lackierung, dazu einen Vierrohrauspuff.
Und da fängst
Du wieder an zu träumen. Von einer Zephyr mit 82 PS aus
903 ccm Hubraum, mit einer einstellbaren Gabel, Fünfspeichen-Rädern
im Campagnolo-Design, 320er Bremsscheiben und vier schlanken
Auspuffrohren. Aber vielleicht stehst Du irgendwann wieder
einmal elektrisiert vor dem Kawasaki-Stand. |
Imre
Paulovits
|
Datenspiegel
Z 650 und Zephyr 750 (207 KB)
|