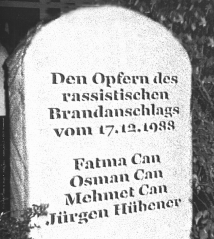 |
Gegen das Vergessen Bündnis gegen Rechts |
|
|
Jahreswechsel |
Schwandorf schweigt, weil sonst "dei Hütt'n au brennt"Vier Jahre vor Mölln und Solingen starben in der Oberpfalz beim Brandanschlag eines Neonazis vier MenschenVon Pitt von Bebenburg (Schwandorf) Schwandorf in der Oberptalz ist eine ganz normale deutsche Kleinstadt, etwas größer als Mölln, aber wesentlich kleiner als Solingen. Noch immer steht ansehnlich renoviert der "Blasturm" von 1459 auf einer Anhöhe, von dem aus in früheren Jahrhunderten der Turmbläser warnte, wenn es in der Stadt brannte oder Feinde anrückten. "Pausenlos kommen Sie in Gefahr", mahnt heute ein überdimensionales Plakat am Ortseingang, doch das bezieht sich weniger auf Schwandorf im besonderen als auf den Straßenverkehr im allgemeinen. Jeder weiß inzwischen, was es bedeutet wenn die Worte Mölln und Solingen in der politischen Diskussion genannt werden: Sie sind Synonyme geworden für Bluttaten von Ausländerfeinden. Auch die Stichworte Hoyerswerda, Hünxe und Rostock fallen, sobald über die Zunahme von rassistisch motivierter Gewalt debattiert wird. Und wenn Fachleute Chroniken des Terrors zusamanenstellen, dann reicht das Erinnerungsvermögen zuweilen so weit zurück, daß Eberswalde erwähnt wird, wo Skinheads im November 1990 einen Angolaner ermordeten. Wer aber spricht von der oberpfälzischen Kleinstadt Schwandorf? "Das Schlimmste ist dieses Schweigen." Fassungslosigkeit und Empörung halten sich bei der Rentnerin Antonie Genzken die Waage, wenn sie das sagt. Und als wolle sie ganz sicher gehen, daß diese unheimliche Wahrheit stimmt, für sie hinzu: "Niemand sagt was - kein Politiker, kein Bürgermeister, kein Landrat." Überhaupt täten die Bayern so, als könne es rechtsradikale Gewalttaten in Bayern nicht geben. In der Nacht zum 17. Dezember 1988, einem Samstag, legte der stadtbekannte Rechtsextremist Josef Saller Feuer im Haus Schwaigerstraße 2, einem Eckhaus mitten im Zentrum von Schwandorf, in dem seines Wissens Ausländer wohnten. Der damals 19jährige zündete mit drei Streichhölzern einen Karton im Hausflur an. Das nach dem Besitzer "Habermeier-Haus" genannte Gebäude brannte völlig nieder. In den Flammen erstickten vier der 16 Menschen, die in dem Haus geschlafen hatten: das türkische Ehepaar Osman und Fatma Can (50 und 44 Jahre alt), ihr elfjähriger Sohn Mehmet und der 41 Jahre alte Deutsche Jürgen Hübener. Sie verbrannten bis zur Unkenntlichkeit. Eine Jugendstrafkammer des Amberger Landgerichts verurteilte den Täter Saller nach dem Erwachsenenstrafrecht zu zwölfeinhalb Jahren Haft - nicht wegen Mordes, sondern lediglich wegen besonders schwerer Brandstiftung. Die Höhe der Strafe begründeten die Richter bei ihrem Urteilsspruch - im Mai 1990! - mit "generalpräventiven" Gründen, da Brandanschläge, vor allem gegen Ausländer, "überhandnehmen". Der Brandstifter gehörte, wie sich während des Prozesses zeigte, zur Führungsebene der heute verbotenen Nationalistischen Front (NF) und versuchte - freilich mit eher geringem Erfolg -, ausländerfeindliche Skinheads in der Oberpfalz zu einer "Wehrsportgruppe" auszubilden. Er pflegte Kontakte zur ebenfalls militant rechtsradikalen Freiheitlichen Arbeiterpartei Deutschlands (FAP) und zur neonazistischen Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD). Auch nach der Greueltat von Schwandorf nahmen nicht alle Ermittler diesen ausgeprägten rechtsradikalen Hintergrund ernst "Fragen nach der NF waren Saller unangenehm", sagte ein Kriminalbeamter vor Gericht aus: "Die Vernehmung wurde dann abgebrochen." Aus der Haft heraus setzte der Brandstifter nach der Verurteilung seine rassistische Hetze fort wie der Buchautor Michael Schmidt herausfand. Nach dessen Angaben zitierte ein Skinhead-Magazin Saller mit den Worten, sein "größter persönlicher Wunsch" sei ein "besatzer- und ausländerfreies Deutschland in germanisch-preußischer Tradition in den Grenzen von 1938, ein Europa ohne Neger, Rote und Hakennasen". Resigniert meinte der Lackierermeistar, bei dem Josef Saller zur Lehre gegangen war, während des Amberger Prozesses: "Das ist unser Brauner gewesen, damit mußten wir fertig werden." Man kannte ihn in Schwandorf. Bei den Protesten gegen die Atom-Wiederaufbereitungsanlage (WAA), die Ende der 80er Jahre im benachbarten Wackersdorf geplant war, lief der Rechtsradikale mit. Dann habe er zuweilen eine Fahne mit einem leicht abgeänderten Hakenkreuz getragen, erzählt die lebhafte, grauhaarige Antonie Genzken: "Da habe ich mich mit ihm angelegt." Viele Demonstranten hätten das nicht richtig gefunden und ihr Vorwürfe gemacht nach dem Motto: "Du bist nicht tolerant." Es ist diese Mischung aus Billigung, Angst und Desinteresse im Umfeld, die die seit dem Anti-WAA-Kampf, politisch engagierte Rentnerin Genzken und ein paar andere Unentwegte so erschüttert. "Reiß dei Mund auf, bis dei Hütt'n au brennt", werde sie von braven Schwandorfern gewarnt wenn sie öffentlich über das Verbrechen des Rechtsradikalen spreche. "An die Nazizeit erinnert mich das", sagt die 69jährige. "Und meine Kinder haben immer zu mir gesagt "Wie konnte es dazu kommen?" Als in Mölln bei einem ganz ähnlichen Brandanschlag drei Türkinnen starben, war sie beim Gedenkmarsch in Schwandorf dabei, der am inzwischen neu errichteten und rosa getünchten Habermeier-Haus endete. Etwa 150 Menschen schlossen sich der Demonstration an. Zu wenige, findet Antonie Genzken: "Da waren wir wieder unter uns. Es sind immer die selben." Die evangelische Kirche, die Grünen, die SPD waren die Organisatoren, der Rest waren Schüler-, Studenten-und andere Jugendverbände. "Von den Stadtoberen ist da nichts drin, die bearbeiten das Thema nicht", hat Irene Maria Sturm beobachtet, die für die Grünen im Stadtrat und im Kreisrat sitzt Landrat Hans Schuierer (SPD) sagt dazu: "Wir wissen ja, daß die CSU seit eh und je die rechte Seite übersieht. Ich bin überzeugt davon, daß diese Leute daran interessiert sind, das möglichst schnell zu vergessen." Der noch immer amtierende CSU-Oberbürgermeister Hans Kraus war nicht einmal bei der ersten Trauerkundgebung vier Wochen nach dem Anschlag in der eigenen Stadt mitgegangen. Seine Begründung damals: Durch die Kundgebung (nicht: durch den Terrorakt) könne der Eindruck entstehen, in Schwandorf sei rechtsradikales Gedankengut zu Hause. Dabei sei der Täter doch "einfach ein irregeleiteter Straftäter", sagt Kraus noch heute. Nach Mölln war es jedoch für das Stadtoberhaupt "einfach anders". Deshalb sei er nun vergangenen Gedenkmarsch hingegangen. Es sei nun wohl doch so, daß Rechtsradikale ihr Unwesen trieben: "Da muß man dann schon in der Öffentlichkeit was sagen." Warum die Tat von Schwandorf im Zusammenhang mit den Attacken der Rechtsradikalen kaum je genannt wird, "das kann ich Ihnen eigentlich nicht sagen". Vielleicht, "weil die Dichte der Vorfälle wahrscheinlich den Zeitraum eingeengt hat?", stochert der Oberbürgermeister im dunkeln. Kraus hebt hervor, wie sehr sich die Stadt und er persönlich nach dem Anschlag in der Schwaigerstraße um die Angehörigen der Opfer gekümmert hätten, mit Wohnung, Geld und Sachleistungen. Viele Türken kamen damals zu der Trauerkundgebung direkt nach der Tat, Menschen, die oft schon lange in Deutschland lebten. Der Koordinierungsrat der Türken in Nordbayern sprach den Wunsch aus, daß die Familie Can und Jürgen Hübener "die letzten Opfer eines solchen Verbrechens auf deutschem Boden waren". Die Hoffnung trog. Es war erst der Anfang. "Solingen, Mölln - es geht so weiter", sagt Süleyman Kellecioglu leise. Seine Frau Leyla hat bei dem Brand im Habermeier-Haus ihre Eltern und ihren kleinen Bruder verloren. Sie fürchtet sich. Sie will zurück in die Heimat. Süleyman dagegen möchte bleiben. Seit zwölf Jahren ist der 28jährige in Deutschland, seit 1984 lebt er in Schwandorf. Anfangs hat er in einem Aluminiumwerk geschafft, jetzt ist der schnauzbärtige junge Mann bei einer Druckerei beschäftigt. Integriert kann man das nicht nennen. Wenig Kontakte habe er mit Deutschen, meint Kellecioglu und senkt schüchtern den Kopf, als habe er da einen Makel. Aber weggehen aus Deutschland? "Ich sage. nicht mehr." Und das, obwohl er noch immer nur ein paar hundert Meter vom Ort des Grauens entfernt wohnt. Der Neubau in der Schwaigerstraße 2 ist ein schickes Geschäftshaus geworden. Unten werden künstliche Blumen, Plüschtiere und andere Geschenkartikel in dem einen Laden angeboten und im anderen Brautmoden, ganz in Weiß. Oben haben Ärzte ihre Praxen bezogen. Schwandorf in der Oberpfalz ist eine ganz normale deutsche Kleinstadt. In einer ordentlich gepflegten Grünanlage stehen drei Denkmäler, die an das Leiden von Menschen erinnern: eins für die Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft, zwei für die Gefallenen in verschiedenen Kriegen. "Unser Opfer - Eure Verpflichtung: Friede", ist in eines davon gemeißelt worden. An die vier Schwandorfer, die ein Rechtsradikaler ermordet hat, erinnert nichts. Der Appell der Grünen, eine Gedenktafel für sie am Habermeier-Haus anzubringen, ist ungehört verhallt. Frankfurter Rundschau, 11.08.1993 |