|
Kernenergie - Aktuell 02. März 2005 © email: Krahmer |
nuclear |
|
Kernenergie - Aktuell 02. März 2005 © email: Krahmer |
nuclear |
Pressemitteilung Max-Planck-Institut für
Plasmaphysik, 2 Dec 2002
Deutsche Fusionsanlage in China weiter
betrieben
Deutsche Fusionsanlage ASDEX in China wieder in
Betrieb gegangen
Erstes Plasma am 2. Dezember
Festveranstaltung in Chengdu / weitreichende Pläne
Von: Isabella Milch
| Eine der weltweit erfolgreichsten Fusionsanlagen der 80er
Jahre, das Experiment ASDEX des Max-Planck-Instituts fuer Plasmaphysik (IPP) in Garching bei Muenchen, wurde am 2. Dezember 2002 im Southwestern Institute of Physics (SWIP) im chinesischen Chengdu (Provinz Sichuan) wieder in Betrieb genommen. Fuenf Jahre nach der Stilllegung 1990 war ASDEX an die Volksrepublik China weitergegeben worden. Die Erzeugung des ersten Plasmas in der wieder aufgebauten Anlage wurde mit einer Festveranstaltung in Chengdu eingeleitet, zu der auch Gaeste aus dem IPP geladen waren. Ziel der Fusionsforschung ist die Entwicklung eines Kraftwerks, das Energie aus der Verschmelzung von Atomkernen gewinnen soll. Die Grossanlage ASDEX (Axialsymmetrisches Divertorexperiment) wurde nach zehn Jahren erfolgreicher Experimentierzeit 1990 mit Betriebsbeginn des Nachfolgers ASDEX Upgrade in Garching stillgelegt. Sie war aufgrund ihrer weltweit Aufsehen erregenden Ergebnisse - darunter die Entdeckung eines Plasmazustandes mit verbesserter Waermeisolation, auf dem die gesamte heutige Fusionsforschung aufbaut - eine der erfolgreichsten Fusionsanlagen der 80er Jahre. Nach der Stillegung meldete die Volksrepublik China Interesse an der Anlage an. 1995 wurde ASDEX - nach Genehmigung durch die deutschen und europaeischen Geldgeber - von einem Team chinesischer Ingenieure und Techniker in Garching abgebaut. In ihre Einzelteile zerlegt, die jeweils numeriert und beschriftet ueber 1000 Kisten fuer Kleinteile und mehrere Container fuer die grossen Elemente fuellten, wurde die Anlage 1996 nach China verschifft. Der Abbau des Experiments, die Dokumentation, der Versand der 350 Tonnen schweren Anlage und ihr Wiederaufbau lagen vollstaendig in der Hand des chinesischen SWIP, das auch alle Kosten uebernahm. Die ASDEX-Mitarbeiter stellten ihre Kenntnis der technischen Details sowie die noetigen Plaene zur Verfuegung und berieten bei der Demontage und beim Wiederaufbau ab 1999 in Chengdu in einem eigens dafuer errichteten neuen Institutsgebaeude. Die Heiz- und Messapparaturen fuer das Plasma sowie die Steuerung und Energieversorgung wurden in China neu gebaut. Solchermassen ergaenzt und unter dem neuen Namen HL-2A (A fuer ASDEX) ging die Anlage am 2. Dezember als vorlaeufig groesstes chinesisches Fusionsexperiment wieder in Betrieb. Dies wird sich aendern, wenn in rund drei Jahren in Hefei das Fusionsexperiment HT-7U in Betrieb gehen wird, das dort im Institut fuer Plasmaphysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entsteht. Waehrend HL-2A in Chengdu vor allem der Grundlagenforschung dienen soll, sucht China mit HT-7U Anschluss an aktuellste Fragen der Fusionsforschung. Anders als die noch mit normalleitenden Kupferspulen ausgeruestete Anlage in Chengdu soll HT-7U das Plasma in einem durch supraleitende Spulen erzeugten Magnetfeld einschliessen und lange Entladungspulse von mehreren Minuten Dauer erreichen. So kann sich das Experiment einem der gegenwaertig aktuellsten Themen widmen: Durch neue Techniken soll es den heute noch pulsweise arbeitenden Fusionsanlagen vom Typ Tokamak den Weg zum Dauerbetrieb bahnen. Darueber hinaus hat China kuerzlich Interesse angemeldet, sich auch an dem internationalen Grossprojekt ITER zu beteiligen. Der Testreaktor ITER - der naechste Schritt der weltweiten Fusionsforschung - wird gegenwaertig von europaeischen, japanischen und russischen Wissenschaftlern gemeinsam vorbereitet. ITER soll zeigen, dass Energiegewinnung durch Fusion physikalisch und technisch moeglich ist und erstmals ein brennendes Fusionsplasma erzeugen. Hintergrund ASDEX war seinerzeit eines der erfolgreichsten Fusionsexperimente: Ziel der Fusionsforschung ist die Entwicklung eines Kraftwerks, das Energie aus der Verschmelzung von Atomkernen gewinnen soll. Brennstoff ist ein duennes ionisiertes Gas, ein Wasserstoffplasma, das zum Zuenden des Fusionsfeuers in Magnetfeldern eingeschlossen und auf hohe Temperaturen aufgeheizt werden muss. Mit dem Experiment ASDEX (Axialsymmetrisches Divertorexperiment) wurde eine spezielle Magnetfeldanordnung - ein Divertor - getestet, die fuer saubere Plasmen sorgen sollte. Das Divertorkonzept hat sich bei der Reinhaltung des Plasmas ausserordentlich bewaehrt. Ueberraschend zeigte sich eine zweite guenstige Wirkung, naemlich ein deutlicher Anstieg der Waermeisolation des Plasmas im sogenannten "High Confinement Regime". Ohne diese Verbesserung waere die Erzeugung eines brennenden Plasmas in einem spaeteren Kraftwerk nicht zu erreichen. Die ASDEX-Ergebnisse waren so bedeutend, dass das in Garching entwickelte Konzept inzwischen weltweit uebernommen wurde. Auch ein spaeteres Fusionskraftwerk wird mit Divertor arbeiten. Seit 1991 betreibt das IPP in Garching den Nachfolger ASDEX Upgrade, der den Divertor unter kraftwerksaehnlichen Bedingungen testet. ASDEX Upgrade ist daher besonders geeignet, den internationalen Testreaktor ITER vorzubereiten. Mit diesem naechsten grossen Schritt will die weltweite Fusionsforschung erstmals ein energielieferndes Fusionsplasma erzeugen. Isabella Milch Max-Planck-Institut fuer Plasmaphysik Presse- und Oeffentlichkeitsarbeit Boltzmannstraße 2 D-85748 Garching Tel. 089-3299-1288 Fax 089-3299-2622 http://www.ipp.mpg.de |
Deutsche Kernreaktoren produzieren zur Zeit
soviel Energie wie noch nie! -Weltrekorde 25.
Februar 2002
Kühle
Witterung treibt Primärenergieverbrauch in die Höhe
13.Februar 2002
Erforschung der
Umwelt-Radioaktivität - eine Naturwissenschaft in der Krise,
25. Sept. 2001
Kernfusion,
jetzt oder nie?
Euro-Wissenschaften
- Infodienst
Bis wann werden Fusionsreaktoren
möglich sein
"Zukunftsorientierte
Energieforschung - Fusionsforschung" im Deutschen Bundestag, am 9. November
2000
Fragen zur Kernfusion
| Kommentar von MM-Physik: Schade, dass Deutschland sich nicht um den Standort ITER beworben hat. Tagespolitische Engstirnigkeit verhinderten dies, bleibt der Standort in der EU zu protegieren. |
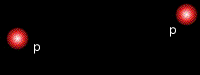
... aber vom pp-Zyklus, dem Feuer der Sterne, bis zu einem
technisch sicheren Kraftwerk ist ein langer und schwieriger
Weg...
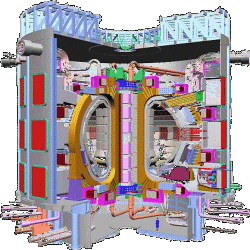 |
Bild von DESY Quelle: Spaziergang durch einen Fusionsreaktor |
| Aktuell
Physik Aktuell Astronomie Aktuell Klima Aktuell Ozon Aktuell Mathematik Aktuell Kernenergie News-Foren Fachliteratur Datenblätter Jobs Kontakmenü Kontake Sucher Suchmaschinen |
Links zur Kernfrage Kernenergie, Kernspaltung, Kernreaktor muss es heissen. Atomenergie ist falsch, denn Atomenergie ist letztlich chemische Energie, die Energie einer brennenden Kerze, die Energie mit der unser Körper arbeitet. Atomhüllen werden da verschmolzen und getrennt, bei Energieumsätzen im Bereich von wenigen Elektronenvolt. Bei Kernumwandlungen (Natürliche Radioaktivität, Kernspaltung, Kernfusion) sind die Kerne von Atomen (100 000 mal kleiner als das Atom) beteiligt mit 100 000 mal grösseren Energieumsatz, bis an die MeV (Megaelektronenvolt=1 000 000 eV). Chemische, Biologische Energie, Photovoltaik arbeiten
mit Atomenergie im Bereich von wenigen Elektronenvolt,
Kernenergie nutzt 100 000 fach höheren Energiemengen. |