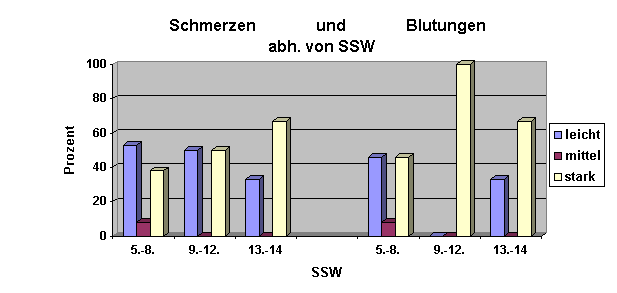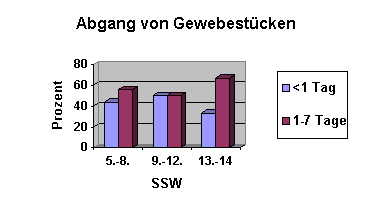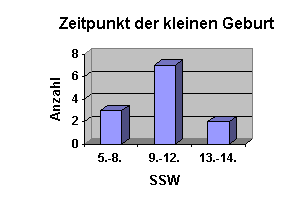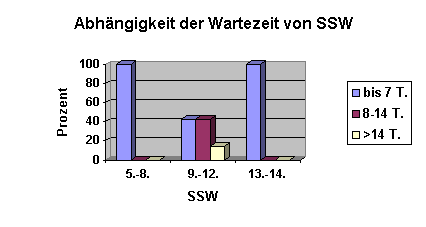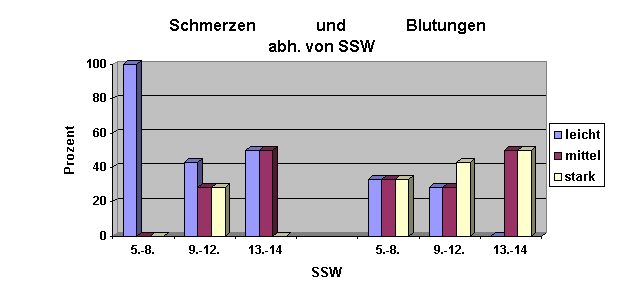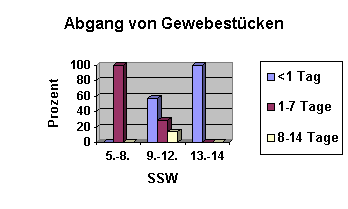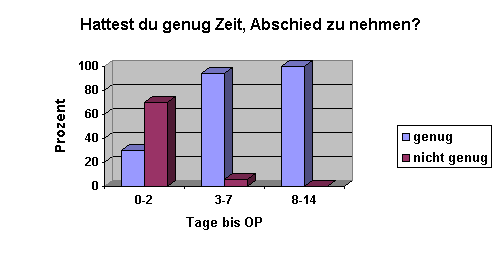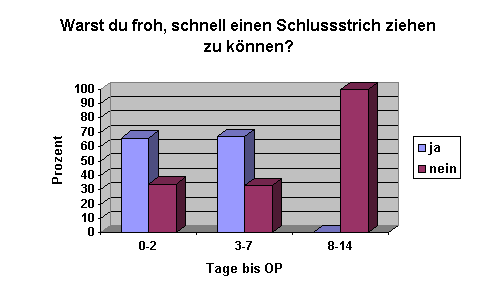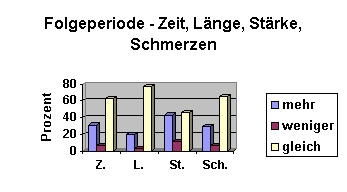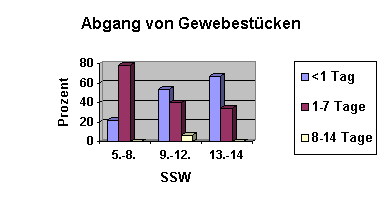Fragebogen-Auswertung
|
Fragebogenauswertung (drucken) Die Ergebnisse - Allgemeiner Teil - Die spontane kleine Geburt - Die abgewartete kleine Geburt - Die Operation - Die Nachsorge - Vergleich der Ergebnisse |
Zur Entstehung des Fragebogens Der Fragebogen (siehe Anhang) ist aus den Diskussionen über „Ausschabung nach einer frühen Fehlgeburt“ im ehemaligen Schmetterlingskinder (heute Frauenworte-)- und Muschelforum entstanden. Es stellten sich mir Fragen wie: - Über welche Wege der Schwangerschaftsbeendigung nach frühen Verlusten werden die betroffenen Frauen durch die Ärzte aufgeklärt? - Welche Weg gehen die Frauen und warum? - Wie erleben sie die verschiedenen Wege körperlich und psychisch? - Welchen Weg würden sie in Zukunft gehen wollen? Der Fragebogen entwickelte sich im Anschluss an die Diskussionen wiederum mit Hilfe der Frauen der beiden Foren. Danke! Beantwortet wurde der Fragebogen von Frauen aus den Foren der Schmetterlingskinder (http://forum.frauenworte.de/dcboard.php), der Muschel (http://muschel.net/), des Maximilianprojekts (http://www.maximilianprojekt.de/) und der Engelskinder (http://www.engelskinder.ch/). Beim Ausfüllen und Auswerten des Bogens fielen ein paar Schwachstellen in den Fragestellungen auf. Auch konnten nicht immer alle Fragen von allen betroffenen Frauen beantwortet werden, doch beides wurde bei der Auswertung berücksichtigt. Bei der folgenden Auswertung werde ich
zunächst die gesammelten Daten/Zahlen vorstellen. Im Anschluss daran werden die
Ergebnisse diskutiert und auch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen
vergleichen. Der Fragebogen wurde von 68 Frauen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, den USA und dem Senegal beantwortet. Es wurden 89 Fragebögen ausgewertet, davon 80 für die Hauptauswertung. Neun weitere wurden extra betrachtet, da es sich um vier Eileiterschwangerschaften handelte und in vier Fällen das Kind erst nach der 16. Schwangerschaftswoche gestorben war. Eine weitere Mutter hatte auf Grund einer medizinischen Indikation eine eingeleitete kleine Geburt in der 14. Schwangerschaftswoche (siehe hierzu „Sonderfälle“). Die frühen Verluste ereigneten sich alle zwischen 1986 und 2005. Der Tod des Kindes wurde jeweils zwischen der 6. und 19. Schwangerschaftswoche festgestellt. Gestorben waren die Kinder den Schätzungen zufolge zwischen der 5. und 16. Schwangerschaftswoche. Von den 80 frühen Verlusten (Tod bis zur 16.SSW, ohne Eileitersschwangerschaften) wurden 20 Schwangerschaften (25%) durch eine „spontane kleine Geburt“ (spn.kG), 12 (15%) durch eine „abgewartete kleine Geburt“ (abg.kG) und die überwiegende Mehrheit, nämlich 48 Schwangerschaften (60%), direkt durch einen operativen Eingriff (oE) beendet. Sechs weitere Operationen wurden nach einer spontanen kleinen Geburt, und zwei nach erfolglosem Abwarten durchgeführt. Insgesamt gab es also 53 operative Eingriffe.
In den 60 Fällen, in denen keine spontane Geburt stattgefunden hatte, waren 33 Frauen (55%) bei der Untersuchung völlig ahnungslos über mögliche Komplikationen gewesen (missed abortion), die anderen hatten leichte bis schwere Blutungen gehabt, wurden von den Ärzten aber trotzdem in den allermeisten Fällen als „missed abortion“ eingestuft (vgl. Literaturrecherche, 3.2 „Einteilung der frühen Fehlgeburten“). 67 Prozent der behandelnden Ärzten hatten die betroffenen Frauen ausschließlich über die Möglichkeit des operativen Eingriffs zur Beendigung der Schwangerschaft aufgeklärt. Nur ein Drittel der Frauen wurde über beide Möglichkeiten, kleine Geburt und operativer Eingriff, informiert. Von den 20 Frauen, die über beide Möglichkeiten aufgeklärt worden waren, wollten neun Mütter ihr Kind durch eine abgewartete kleine Geburt gehen lassen und elf durch einen operativen Eingriff. Tatsächlich haben davon dann sieben Frauen (35%) die Schwangerschaft durch eine kleine Geburt beendet und 13 Frauen (65%) durch einen operativen Eingriff. In zwei Fällen wollten die betroffenen Mütter zwar auf eine kleine Geburt warten, entschieden sich später wegen steigender Infektionsgefahr bzw. psychischer Belastung aber doch für eine Operation. In einem dritten Fall gab es schon von Beginn an körperliche Probleme, die zur Operation führten. Das heißt, dass in diesen Fällen die Wahl nicht frei von körperlichen oder psychischen Komplikationen getroffen werden konnte. Von den 40 Frauen, die sagten, dass sie nur über den operativen Eingriff informiert worden waren, haben ihn auch 35 (87,5%) vornehmen lassen. Fünf Frauen (12,5%) haben dagegen trotzdem ihre Schwangerschaft durch eine kleine Geburt beendet.
Bei gleichwertiger Information über beide Wege
und ohne gesundheitliches Risiko sagten 23 von 38 Frauen (61%), dass sie eine
kleine Geburt gewählt hätten und zwölf Frauen (32%), dass sie sich einer
Operation unterziehen würden. Drei Frauen haben ihre Antwort etwas weiter
differenziert: Judith sagt: „Ich hätte auf jeden Fall nicht sofort eine Ausschabung machen lassen! Ich hätte mir die Zeit genommen, um es zu begreifen und Abschied zu nehmen, hätte mir Hilfe bei meinem Homöopathen genommen.“ S. meint dazu : „Weil ich die Schmerzen und die starke Blutung ziemlich fürchten würde, würde ich mich so ab der achten bis zehnten Woche vermutlich eher wieder für eine Ausschabung entscheiden. Davor würde ich vermutlich schon einen natürlichen Abgang abwarten.“ Diana glaubt: „Für meinen Körper hätte ich die kleine Geburt gewählt, aber da ich ja vorher schon eine Totgeburt hatte, konnte ich das mit meiner Psyche leider nicht vereinbaren.“ 29 Frauen (47%) wurde von ihren Ärzten keine Zeit gegeben, eine Entscheidung zu treffen oder ins Krankenhaus zu gehen. Zwei wollten keine Zeit, sondern so schnell wie möglich die Schwangerschaft beenden. Den anderen wurden ein paar Tage, bis beliebig lange Zeit gegeben. Auffällig dabei ist: Nur 10 von 39 Frauen, die nur über die Möglichkeit des operativen Eingriffs aufgeklärt worden waren, wurde mehr als ein Tag Zeit gegeben, ins Krankenhaus zu gehen. Somit hatten auch nur diese zehn Frauen die Gelegenheit gehabt, sich mit der Situation auseinander zu setzen und von ihrem Kind Abschied zu nehmen. Alle Frauen, denen mehr als drei Tage Zeit gelassen wurde, die Operation vornehmen zu lassen, waren damit auch zufrieden. Dagegen hätten aber insgesamt 21 Frauen gerne mehr Zeit fürs Abschiednehmen gehabt! Dies waren durchweg Frauen, denen weniger als drei Tage Zeit gelassen worden war, um ins Krankenhaus zu gehen. 22 von 56 Frauen (39%) gaben an, von ihrem Arzt über die Möglichkeit einer genetischen Untersuchung des Kindes aufgeklärt worden zu sein. Aber mehr als die Hälfte hätte gerne mehr darüber erfahren und 21 wären sogar bereit gewesen, eine genetische Untersuchung des Kindes schon nach der ersten Fehlgeburt selber zu bezahlen. Das Ergebnis einer genetischen Untersuchung der Eltern hat manchen bei der weiteren Familienplanung geholfen. Uschi erklärt dies
so: „Uns hat die genetische Untersuchung sehr beruhigt und ermutigt noch mal
eine Schwangerschaft zu wagen, eben weil wir dadurch ganz eindeutig wussten,
dass wir Eltern beide kerngesund sind. Wir hatten uns nämlich nach den beiden
Verlusten lange unterhalten und waren zu dem Entschluss gekommen, dass wir eine
weitere Schwangerschaft nur wagen wollten, wenn bei uns genetisch alles in
Ordnung wäre, ansonsten hätten wir uns mit unseren beiden gesunden Kindern
zufrieden gegeben. Auch Regina B. ist froh, dass sie eine Untersuchung hat machen lassen: „Die genetische Untersuchung hat uns sehr wohl weitergeholfen: Da bei mir die Gerinnungsstörung festgestellt wurde, haben wir die Hoffnung gehabt, mit erhöhter Zugabe von Folsäure ein weiteres Kind bekommen zu können. Nachdem uns jedoch auch *Ronja danach (trotz Folsäure!) verlassen hatte, habe ich Fachliteratur gewälzt (Bücher von Prof. Heilmann etc.) und mich selbst ‚schlau gemacht’, da ich durch die Foren wie Schmetterlingskinder und Muschel von ‚anderen Behandlungsmethoden’ erfahren hatte, wie Aspirin und Heparin. Das alles habe ich mit meinem Arzt diskutiert, der sich dann noch mal ‚rückversichert’ hat, auf Basis der Fakten, die ich ihm lieferte und mit mir und meinem Mann einen ‚Behandlungsplan’ aufgestellt hat, wenn ich erneut schwanger werden sollte. Ohne die genetische Untersuchung hätte ich nie den Mut gehabt, noch zweimal schwanger zu werden…. Das Ergebnis davon habe ich gerade ins Bett gebracht……“ Andere brachte eine Untersuchung leider nicht weiter. Inka hierzu: „Ich
würde sagen, mir persönlich hat die genetische Untersuchung kaum geholfen. Dieses Ergebnis hat mir eigentlich nichts
gebracht, weil uns auch niemand sagen konnte, warum bei uns gehäuft Gendefekte
auftreten. Es wird immer nur von einem ‚geringfügig erhöhten Risiko’
gesprochen. Worin das besteht und wie das evtl. aussehen könnte ist aber rein
spekulativ. Fakt ist, wir sind genetisch gesund und haben kein erhöhtes Risiko
von dieser Seite aus. 20 Kinder wurden zwischen der 5. und 14. Schwangerschaftswoche durch eine spontane kleine Geburt geboren. Die überwiegende Mehrzahl der Frauen musste ihre Kinder in der sehr frühen Schwangerschaft (um die 6. SSW) wieder gehen lassen.
Zwei Frauen hatten während der Geburt sehr starke Krämpfe und/oder Blutungen, was in einem Fall zu einer Notoperation führte. Alle anderen kleinen Geburten verliefen ohne Komplikationen. Die Hälfte der Frauen empfand die Geburt als sehr schmerzhaft. Alle anderen gaben an, dass sie die Schmerzen zwar stärker als eine Regelblutung empfanden, aber dass sie auszuhalten waren; wiederum andere hatten nur leichte Schmerzen.
Dabei scheinen in den ersten Wochen die Schmerzen seltener stark zu sein als später in der Schwangerschaft. Elf Frauen gaben an, dass sie sehr viel Blut verloren hatten. Auch das scheint abhängig von der Schwangerschaftswoche zu sein. Es hat 20 Minuten bis drei Tage gedauert, bis alle Gewebestücke abgegangen waren, der Durchschnitt lag bei etwa einem Tag. Hierbei gibt es anscheinend keinen Zusammenhang zur Schwangerschaftswoche.
Nachblutungen haben zwischen 4 und 21 Tage angehalten, mit einem Durchschnitt von sieben Tagen. Verglichen mit einer normalen Periode empfanden die Frauen die Stärke dieser Blutung sehr unterschiedlich: Bei manchen war sie weniger stark bzw. gleich stark bis stärker als üblich. Meist war die Blutung genauso stark wie eine Regelblutung. Bei der Nachuntersuchung war die spontane Fehlgeburt in 13 Fällen (65%) als „vollständig“ eingestuft worden. Bei den sieben „unvollständigen Fehlgeburten“ wurde in sechs Fällen noch nachoperiert. Nur in einem Fall wurde abgewartet, ob sich die Reste noch von alleine lösen würden. In allen Fällen verblieben anschließend keine Schwangerschaftsreste mehr in den Gebärmüttern. Bei einer Frau wurde sogar nach allen drei „complete abortions“ jeweils nachoperiert. Vier Frauen hatten nach der Geburt noch körperliche Probleme, wie Müdigkeit, Gebärmutterkrämpfe, die Periode kam nicht zurück oder niedrigem Blutdruck mit Schwindel. Die Hälfte der betroffenen Frauen gab an, nach der spontanen kleinen Geburt seelische Probleme gehabt zu haben. Hierbei handelte es sich um Schuldgefühle, um Trauer und Enttäuschung, um Probleme wegen vorangegangener Totgeburt und der Angst, nie ein lebendes Kind zu haben. Sechs Frauen haben ihr Kind nach der Geburt gesehen. Drei waren sich nicht sicher, da das Gewebe in die Toilette gefallen war, und sie es nicht mehr genau erkennen konnten. 12 von 15 (80%) Frauen gaben an, dass es für sie jeweils richtig war, das Kind gesehen bzw. nicht gesehen zu haben. Diejenigen, die diese Frage mit „Nein“ beantwortet haben, waren Frauen, die ihre Kinder nicht bzw. nicht richtig gesehen hatten. Sechs Frauen haben ihr Kind oder sein „Nestchen“ beerdigt. Eine Frau hat es im Kamin verbrannt. Für die meisten Frauen, die ihr Kind nicht gesehen haben, wäre es ein großer Wunsch gewesen, das Kind beerdigen zu können. Die betroffenen Frauen haben 25 bis 42 Tage auf ihre erste Periode nach der Fehlgeburt gewartet, im Schnitt 31 Tage. Diese war bei neun Frauen genauso wie jede andere Regel. Bei jeweils drei Frauen kam die Periode später und dauerte länger. Weitere Angaben waren: Die Periode war kürzer, stärker, schwächer, schmerzhafter, weniger schmerzhaft als normalerweise.
65% der Frauen sind nach ihrem Verlust wieder schwanger geworden. Bei einigen ging es sehr schnell (innerhalb eines Monats), andere warteten länger (mehrere Jahre), der Durchschnitt lag bei 5 Monaten. Leider endeten die meisten Folge-Schwangerschaften (62%) wieder mit einem Verlust, davon sieben im ersten Schwangerschaftsdrittel und eine im zweiten. Fünf Kinder (38%) sind inzwischen gesund geboren worden, ein Kind war zum Zeitpunkt der Umfrage noch unterwegs. Bemerkenswert ist, dass alle Frauen, die die Frage nach ihrem gewünschten Weg bei einem weiteren frühen Verlust beantwortet haben (11 von 20), sagten, dass sie auf eine kleine Geburt warten würden. Begründungen hierfür waren folgende: Sie vertrauen ihrem Körper: - Monika B.: „Es hat das erste Mal funktioniert, wird es also auch das zweite Mal funktionieren. Da vertraue ich meinem Körper. Ich möchte mich dem nicht entziehen.“ - Silke: „Ich würde in jedem Fall eine kleine Geburt abwarten, weil es mir natürlicher erscheint, und weil ich nach dieser Erfahrung mehr Vertrauen in meinen Körper habe und denke, dass er es wieder alleine schaffen würde.“ Sie möchten sich in Ruhe und Würde von
ihrem Kind verabschieden: - Leena: „Ich würde gern meinem Kind den letzten Dienst erweisen, nicht aus mir herausgeholt zu werden, sondern geboren zu werden.“ - Antje H.: „Nur dann kann man sich richtig verabschieden.“ Sie denken, es wäre für sie seelisch
leichter: - Ayshe: „Ich würde lieber warten, eine gewisse Zeit, um mich seelisch damit abzufinden, darauf einzustellen, Abschied zu nehmen.“ - Sylvia: „Es ist die sanftere Methode Abschied zu nehmen, mein Mann kann dabei sein. Meine gewohnte Umgebung ist in dem Moment so wichtig.“ - Conny: „Ich würde immer versuchen eine kleine Geburt zu veranlassen, da man einen intensiveren Bezug zum Kind bekommt.“ 14 Mütter wollten ihr Kind durch eine abgewartete kleine Geburt gehen lassen. Bei zwei Frauen musste schließlich doch ein operativer Eingriff vorgenommen werden, da es zu medizinischen bzw. psychischen Komplikationen gekommen war. In einem Fall wurde die kleine Geburt auf Wunsch der Mutter mit Hilfe der Abtreibungspille Mifegyne eingeleitet. Die restlichen elf Frauen haben die Geburt ohne jegliche medizinische Intervention abgewartet und beendet. Für die meisten Mütter (77%), die sich für eine kleine Geburt entschieden hatten, war es nicht die erste Schwangerschaft gewesen. 61 Prozent haben mit Geburtserfahrung diesen Schritt gewählt. 46 Prozent der Frauen brachten die Erfahrung eines vorangegangenen Verlustes mit in die Entscheidung ein.
Für die Entscheidung zur kleinen Geburt gab es folgende Gründe: - Angst vor dem Krankenhaus/der Operation, - Wunsch, der Natur freien Lauf zu lassen, - Wunsch, sich in Ruhe, in Würde und in Liebe von dem Kind zu verabschieden und es sehen zu können, - Wissen, dass es nicht so risikoreich ist, wie die Ärzte gerne behaupten, - organisatorische Probleme. Antje schreibt dazu: „Nach einer Ausschabung wollte ich so etwas nie wieder mit mir machen lassen, und ich habe durch den Kontakt mit anderen betroffenen Frauen erfahren, dass es auch eine andere Möglichkeiten gibt, und die fühlte sich für meinen Bauch einfach besser an.“ Tamara erklärt: „Mir war es wichtig, dass Jamie mich auf
‚normalen’ Wege verlässt, ich ihn sehen und mich verabschieden konnte!“ Katrin L. erzählt: „Ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen und war daher froh, dass ich schon Berichte von Frauen kannte, die ihre Babys auf diesem Weg haben gehen lassen. Ansonsten wäre ich vielleicht in die ‚Routine’ gerutscht...“ Bis auf zwei Frauen waren alle ausführlich über mögliche Komplikationen und Risiken informiert, wie etwa: - zu lange, zu starke Blutungen/Kreislaufprobleme, - starke Schmerzen, - Fieber, Infektionen, - Plazentareste/incomplete abortion/Nachoperation, - Verkleben der Eierstöcke/Infertilität, - psychische Belastung. In den meisten Fällen stand der Gynäkologe bzw. die Hebamme zumindest eingeschränkt hinter der Entscheidung der Frau, auf die kleine Geburt zu warten. Dabei wurde den Frauen in der Regel auch kein zeitlicher Rahmen vorgegeben, sie hatten beliebig lange Zeit, auf die Geburt zu warten. Die kleinen Geburten lagen alle zwischen der 6. und 14. Schwangerschaftswoche (Durchschnitt bei 10.SSW) und 2 bis 23 Tage nach der Diagnose, mit einer durchschnittlichen Wartezeit von sieben Tagen. Festgestellt wurde der Tod des Kindes zwischen der 6. und 14. Schwangerschaftswoche, gestorben waren die Babys vermutlich zwischen der 6. und 12. Schwangerschaftswoche.
Dabei scheint es keinen Zusammenhang zwischen der Wartezeit und der Schwangerschaftswoche zu geben. Auch konnte keine Verbindung zwischen dem vermutlichen Todeszeitpunkt des Babys und dem Eintritt der kleinen Geburt gefunden werden. Allerdings hatten fünf der betroffenen Frauen zum Zeitpunkt der Diagnose schon Blutungen. Bei ihnen betrug die durchschnittliche Wartezeit vier Tage, bei den anderen lag der Schnitt bei 12 Tagen. Dies weist darauf hin, dass Blutungen bei der Erstuntersuchung zu einer relativ schnellen Beendigung der Schwangerschaft führen können. Fünf Frauen meinen, dass ihr Wissen über den Tod ihres Kindes die Geburt vorangetrieben habe. Kerstin sagt hierzu: „Ich habe das Einsetzen der kleinen Geburt dann erlebt, als ich selbst dazu bereit war loszulassen.“ Antje erzählt: „Als ich selber meinem Kind sagte, dass es in Ordnung sei, wenn es geht, und ich es immer lieben werde und selber losgelassen habe, kamen die Blutungen richtig in Schwung.“ Silvia glaubt: „Sonst hätte ich mich extrem gegen die Vorgänge gewehrt, und so konnte ich mich verabschieden und es gehen lassen.“ Nur eine Mutter sagte, dass das Wissen um den Tod ihres Kindes die kleine Geburt eher verhindert habe – sie musste sich schließlich auch einer Operation unterziehen. Wie die Mütter die Tage des Wartens erlebt haben, beschreiben sie durch folgende Ausdrücke: - Bewusstes Abschiednehmen, Trauer, - schlechter Traum, Ausnahmezustand, sehr schrecklich, schlimme Zeit, wie im Strudel, - Zweifel, Angst, Verzweiflung, - organisierend, vorbereitend. Fast ausnahmslos hatten sie in diesen Tagen Zeit, von ihrem Kind Abschied zu nehmen und den Trauerprozess zu beginnen. Nur zweien war es schwergefallen, ein totes Kind zu tragen. Neun Frauen meinten, dass sie zwei Wochen und länger auf die kleine Geburt gewartet hätten. Nur zwei Frauen empfanden während der kleinen Geburt starke körperliche Schmerzen. Alle anderen fanden die kleine Geburt nicht schmerzhaft (36%), etwas schmerzhaft (27%) oder schmerzhaft, aber aushaltbar (18%). Die empfundenen Schmerzen scheinen dabei z.T. bei fortgeschrittener Schwangerschaft stärker zu werden (vgl. auch spontane kleine Geburt).
Die Hälfte der Frauen hat für einen gewissen Zeitraum stark geblutet, ein Viertel hatte etwas stärkere Blutungen als bei einer normalen Periode und die anderen hatten keine starken Blutungen. Auch die Blutungen scheinen mit fortgeschrittener Schwangerschaft eher stärker zu werden. Es hat von weniger als einer Stunde bis zu zwei Wochen gedauert, bis die meisten Gewebestücke abgegangen waren, im Schnitt acht Tage.
Insgesamt haben die Nachblutungen 3 Tage bis 3 Wochen angehalten, mit einem Schnitt von 10 Tagen. Wobei die Blutungen in den ersten Tagen in der Regel stärker waren als bei einer normalen Periode, danach in eine regelähnliche Blutung übergingen, um in einer Schmierblutung zu enden. In keinem Fall musste eine Not-Operation vorgenommen werden. Das heißt, es kam bei keiner der betroffenen Frauen zu einem zu starken Blutverlust oder unerträglichen Schmerzen. Alle kleinen Geburten wurden bei der Nachuntersuchung als komplett eingestuft und so brauchte in keinem Fall nachoperiert zu werden. Zum Teil wurde bis nach der ersten Periode danach abgewartet, um nachzusehen, ob alle Gewebestücke abgegangen waren. Das heißt, dass nach 23 Tagen in 86 Prozent der Fälle die Fehlgeburt vollständig war. Auch hatten die allermeisten Mütter anschließend keine anderen körperlichen Probleme. Nur eine hatte für zwei Monate stärkere Perioden und eine weitere klagte über eine schmerzende Dammnarbe und starkes Schwitzen für sechs Wochen. Die Hälfte der Frauen wusste, dass man eine kleine Geburt naturheilkundlich unterstützen kann. Sie haben z.B. Sepia, Pulsatilla, Arnica oder Bachblüten genommen. Keine der Frauen hatte wegen der kleinen Geburt seelische Probleme – wohl aber natürlich wegen des Verlustes. Silvia sagt sogar: „Es war ein großartiges Erlebnis für mich, das zu schaffen und mein Baby auch ganz kurz kennen zu lernen.“ Auch Katrin L. ist überzeugt: „Es war der beste Weg für mich/uns, den Tod unseres Babys zu verarbeiten und Abschied zu nehmen.“ Fünf der zwölf Frauen haben ihr Kind gesehen und waren froh darüber. Zwei davon haben es zuhause bzw. auf einem Sammelgrab beerdigt. Von den anderen hätten weitere drei ihr Baby auch gerne beerdigt, haben es aber gar nicht gesehen oder dies vorher nicht bedacht. Die Frauen haben 25 bis 49 Tage auf ihre erste Periode nach der kleinen Geburt gewartet, im Durchschnitt 32 Tage. Oft verlief diese Periode genauso wie vorher auch, doch z.T. kam sie später, dauerte etwas länger, war stärker oder schmerzhafter.
Sieben Frauen (60%) waren nach ihrer kleinen Geburt, zum Zeitpunkt der Umfrage, wieder schwanger geworden, innerhalb von zwei bis acht Monaten, im Schnitt nach vier Monaten. Leider mussten zwei von ihnen (33%) ihr Kind wieder in der Frühschwangerschaft hergeben. Ausnahmslos alle Mütter sagten, dass die kleine Geburt der richtige Weg des Abschieds für sie gewesen sei, und sie diesen Weg wieder wählen würden. Sie glauben auch, dass für sie ein operativer Eingriff mehr körperliche und/oder seelische Probleme gebracht hätte. Tamara sagt: „Eine Operation wäre schlimm gewesen, körperlich und seelisch, da ich mich danach sicher beraubt gefühlt hätte. Es wären Bedenken geblieben. Bei der kleinen Geburt ist alles so ‚klar’ gewesen.“ Auch Katrin „würde auf jeden Fall wieder
auf eine kleine Geburt warten. Es ist für mich der beste Weg, um mich von
meinem Baby zu verabschieden und ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die
Verarbeitung.“ Angelika schreibt dazu: „Eine Operation wäre sicher nicht so einfach gewesen, allein der Krankenhausaufenthalt wäre wesentlich stressiger gewesen.“ 2 der 14 Frauen, die auf eine kleine Geburt warteten, haben sich während des Abwartens schließlich doch noch zu einer Operation entschlossen. Christiane wollte zwar eine kleine Geburt abwarten, hat sich aber nach zwei Wochen des Wartens doch zu einer Operation entschieden. In diesen zwei Wochen hatte sie Zeit gehabt, sich von ihrem Kind zu verabschieden und die Operation war somit in Ordnung für sie. Christiane hatte folgende Gründe, sich letztendlich für den operativen Eingriff zu entscheiden: „Es war davon auszugehen, dass es zu keiner natürlichen Geburt kommen würde. Ich wollte den ‚Zustand’ beenden, weil ich nicht damit klar gekommen bin, das Kindlein festzuhalten. Ich bin überzeugt davon, dass es bei dieser Fehlgeburt zu keiner kleinen Geburt gekommen wäre, weil ich nicht loslassen konnte/wollte.“ Diana bat nach mehreren Tagen im Krankenhaus um eine Operation. Die Ärzte wollten auf Grund der Größe des Kindes (14.SSW) die Geburt eigentlich abwarten. Doch nachdem das Baby nach langen Blutungen und trotz strenger Bettruhe doch gestorben war, wollte Diana die Operation: „Ich war es ja diesmal, die wollte, dass operiert wird. Ich hatte in der Nacht zuvor so starke Blutungen, dass ich Angst hatte, zu verbluten. Morgens bekam ich ein Zäpfchen vor den Muttermund gelegt. Die Wehen waren so schrecklich, dass ich nur noch in den OP wollte. Ob mein Kind von alleine kam oder ob es leider doch aus mir rausgeschnitten (wie schrecklich) wurde, dass weiß ich nicht, und möchte es auch nicht wissen.“ Weiter erklärt sie: „Ich hatte Angst, dass ich das Baby auf der Toilette verlieren würde. Ich hatte Angst, es zu sehen. Ich bin vor Schmerz bald durchgedreht. Und dann kam alles wieder von der Totgeburt meines Sohnes hoch, das war das Schlimmste.“ Eine Mutter aus Österreich hat die kleine Geburt in der 14. Schwangerschaftswoche, drei Tage nach der Diagnose „missed abortion“, mittels der „Abtreibungspille“ Mifegyne und Prostaglandintabletten im Krankenhaus einleiten lassen. Diese Methode wird in der Wissenschaft immer häufiger diskutiert, doch bisher, zumindest in Deutschland, äußerst selten angewandt (vgl. auch wiss. Literaturrecherche, „Behandlung früher Fehlgeburten“). Astrids Erfahrungen habe ich zum größten Teil in die Auswertungen
über die abgewartete kleine Geburt einfließen lassen. Doch ein paar ergänzende
Bemerkungen möchte ich an dieser Stelle hinzufügen: Astrid ist rein zufällig bei der Suche nach einem Krankenhaus für einen operativen Eingriff auf einen Mifegyne-Spezialisten gestoßen. Dieser war der erste, der meinte, dass sie doch auch ohne Kürettage auskommen könne. Sie hatte also die Wahl und entschied sich „für das ‚bewusste’ Loslassen, statt die Ärzte das einfach ‚machen zu lassen’.“ Mögliche Nebenwirkungen dieser Methode sind ähnlich wie bei der kleinen Geburt: - sehr starke Blutungen, - Nach-Kürettage, - Nebenwirkungen der Tabletten, wie z.B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Astrids kleine Geburt verlief ohne Komplikationen und war durch die Gabe von Schmerzmitteln auch nicht zu schmerzhaft. Sie verlor zwar viel Blut, hatte es sich aber schlimmer vorgestellt. Das Baby und die meisten größeren Gewebestücke verlor sie innerhalb kürzester Zeit und die Geburt war vollständig. Astrid konnte ihr Kind „auffangen“, es sich intensiv betrachten und später in einer Kindergrabstätte für Fehl- und Totgeburten bestatten. Vielleicht gibt es ja in der Zukunft mehr Frauen, die den Weg der „medikamentösen Einleitung einer kleinen Geburt“ gehen, und darüber berichten. Dann könnte auch hierzu mehr Literatur und Erfahrungen beigetragen werden. Denn auch dies sollte ein Weg sein, der betroffenen Müttern als Möglichkeit – zwischen der „rein passiv abgewarteten kleinen Geburt“ und dem „operativen Eingriff“ – gegeben werden sollte! 53 der befragten Frauen haben nach der Diagnose einer Fehlgeburt einen operativen Eingriff vornehmen lassen. Davon sagten 32 Frauen (60%), dass die Operation ihre bewusste Entscheidung gewesen sei, 8 konnten diese Frage nicht eindeutig mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten, „aber sie hätten nichts anderes gewusst“, und 13 gaben an, dass es nicht ihre eigene Entscheidung gewesen sei. Das heißt, dass praktisch für 21 der befragten Frauen die Entscheidung zur Operation von ihren behandelnden Ärzten getroffen wurde. Dazu kommen noch sechs weitere Frauen, die sich nur für eine Operation entschieden haben, weil sie „keine Alternative kannten“. Somit war die Operation bei 55% der Frauen nicht wirklich selbstbestimmt, sondern ihnen standen keine Alternativen zur Verfügung. Sechs der 53 Frauen hatten vorher eine spontane kleine Geburt durchlebt und wurden wegen Geweberesten nachoperiert und zwei Frauen ließen sich nach einer erfolglosen abgewarteten kleinen Geburt operieren (vgl. obige Kapitel). Die meisten Frauen (85%) wurden direkt operiert.
Für 60 Prozent der Mütter war es nicht die erste Schwangerschaft gewesen. 42 Prozent hatten zuvor schon ein Kind zur Welt gebracht und 46 Prozent hatten vorher schon mal einen Verlust erlitten. Für einen operativen Eingriff sprachen folgende Gründe: - Angst vor der kleinen Geburt: erhöhte Infektionsgefahr, Unfruchtbarkeit, Gewebereste, starke Blutungen, starke Schmerzen, Nach-Kürettage; - Arzt hatte vor der kleinen Geburt gewarnt; - kein totes Kind tragen zu wollen; - Angst, Kind an „unpassendem“ Ort zu verlieren; - Operation kontrollierbarer/planbarer; - starke Blutungen und Schmerzen schon bei Diagnose; - sich schnell wieder gesund fühlen wollen; - es schnell hinter sich bringen wollen/Neuanfang/Schlussstrich ziehen; - psychische Belastung. In den allermeisten Fällen war eine Ausschabung vorgenommen worden. Fünfmal wurde eine Saugkürettage angewandt und dreimal eine Kombination beider Methoden. Einmal musste wegen Blutes im Bauchraum eine Laparaskopie (Bauchspiegelung) gemacht werden. Die Frauen wurden vor der Operation in der Regel über Risiken und Nebenwirkungen der Operation aufgeklärt. Folgende wurden genannt: - Verletzungen der Gebärmutter, evtl. Entfernung der Gebärmutter nötig, - Verletzung des Muttermundes, Muttermundschwäche, - Verletzung angrenzender Organe, - Infektionen, - Gewebereste, Nachoperation, - starke Blutungen, - Infertilität, - Narkoserisiken. Die Operationen lagen alle zwischen der 6. und 19. Schwangerschaftswoche, die meisten in der 10. Schwangerschaftswoche.
Obwohl es nur zwei Notfälle gab, wegen sehr starker Blutungen und Schmerzen, die eine schnelle Operation nötig machten, erfolgte die Operation in den meisten Fällen schon einen Tag nach der Fehlgeburtsdiagnose, im Schnitt nach 2 ½ Tagen. Einmal wurde erst nach 14 Tagen operiert, da diese Mutter so lange auf die kleine Geburt gewartet hatte (siehe auch „Die abgewartete kleine Geburt“).
27 Frauen gaben an, dass sie genug Zeit gehabt
hätten, sich mit der Situation auseinander zu setzen, 29 Frauen waren
froh gewesen, schnell einen Schlussstrich ziehen zu können. Irene erklärt
dies so: „Da ich immer direkt einen Tag nach der Diagnose einen Termin zur
Ausschabung bekommen habe (ich habe selbst ausdrücklich darum gebeten) lag nie
viel Zeit dazwischen. Die kurze Zeit, die da war, habe ich als sehr belastend
empfunden, und ich war froh, wenn ich den Eingriff hinter mir hatte. Ich hätte
es auf keinen Fall länger ausgehalten. Ich konnte erst dann mit dem Verarbeiten
beginnen.“ Auch Aline wollte eine schnelle Operation: „Der Frauenarzt
drängte auf eine schnelle Ausschabung. Dieses Drängen hat mich sehr
verunsichert, ich dachte es sei gefährlich für mich, ein totes Kind im Bauch zu
haben. Deshalb wollte ich, dass ‚diese Leiche’ möglichst schnell entfernt
wird. Ich fand das richtig ekelig und war fast enttäuscht, dass ich zwei
Tage auf den Operationstermin warten musste.“ Saskia erging es ähnlich:
„Bei meiner ersten Fehlgeburt war die Operation direkt einen Tag nach der
Diagnose. Ich war von der Diagnose sehr geschockt, habe den ganzen Tag und
Abend nur geweint. Im Nachhinein war ich aber auch ganz froh, dass die
Operation so schnell folgte. Denn bei meiner zweiten Fehlgeburt lagen einige
Tage dazwischen, die für mich sehr belastend waren. Ich wusste, mein Kind ist
tot, aber ich musste es noch mehrere Tage in meinem Bauch haben. Richtig
verabschieden konnte ich mich eh erst NACH der Operation.“ Einer Frau waren die vier Tage Wartezeit bis zur Operation sogar zu viel gewesen. Maja hätte gerne noch schneller einen Schlussstrich gezogen. Sie sagt: „Ich fand es sehr belastend, mit einem toten Baby schwanger zu sein. Ich habe drei Tage vor dem Ausschabungstermin dann angefangen zu bluten, wusste nicht, ob das normal ist. Ich bin ins Krankenhaus, dort haben sie gesagt, nun ist die ‚missed abortion’ ein ‚abortus incompletus’, wollten aber die Ausschabung nicht machen, da ich ja einen Termin hatte und kein Notfall sei. Hatte die kommenden zwei Tage dann irre Schmerzen, und dann habe ich ja mein Kind stückchenweise verloren, ich fand das so schrecklich! Bin am nächsten Tag wieder ins Krankenhaus, aber sie haben mich einfach nicht operiert, sondern wieder nach Hause geschickt, ich sei ja kein Notfall. Nicht nur wegen des stückchenweisen Verlustes, auch wegen der Hammerschmerzen fand ich es total schlimm. Ich habe mittlerweile ein gesundes Baby, die Schmerzen, die ich damals hatte, waren wehenähnlich.“ Die andere Hälfte der Frauen hätte dagegen
gerne mehr Zeit gehabt, sich mit der Situation auseinander zu setzen. 22 Frauen
gaben zudem an, nicht genug Zeit für das Abschiednehmen gehabt zu haben. Miriam
hierzu: „Die Zeit war viel zu kurz (ca. 1-2 Stunden), ich hatte das Gefühl,
dass ich richtig überrollt werde. Mir wurde zwar auch die Wahl gelassen, noch
An obiger Graphik wird sehr deutlich, dass die meisten Frauen mindestens drei Tage bis zur Operation brauchen, um die Gelegenheit zu haben, sich mit der Situation einer Fehlgeburt auseinander zu setzen.
Noch etwas deutlicher wird diese
Dreitagesfrist, wenn es darum geht, sich von seinem Kind zu verabschieden und
den Trauerprozess zu beginnen. Bianca schreibt dazu: „Ich war froh, dass
ich die fünf Tage zwischen Diagnose und Operation hatte, um mich von meinem
Baby verabschieden zu können. Ich habe die Zeit gebraucht, um die Trauer
wirklich zu spüren und weinen zu können. Ich glaube, wenn ich sofort eine
Ausschabung bekommen hätte, dann hätte mir dieser Abschied gefehlt, um zu
begreifen, was ich da erlebe und dass der Verlust wirklich real ist. Nach der
Diagnose habe ich mich zuerst wie betäubt gefühlt, habe zwar geweint, aber
alles irgendwie mechanisch erledigt. Erst nach zwei bis drei Tagen habe ich
realisiert, dass es die letzten Tage mit meinem Baby im Bauch sind. Und das war
gut so. Freunde und Verwandte in meinem Umfeld fanden es furchtbar, dass ich
noch ‚so lange’ warten musste - ich fand es sehr hilfreich, um meinen Trauerweg
zu finden.“ Auch Uschi war es sehr wichtig gewesen, Zeit für den
Abschied gehabt zu haben: „Bei der zweiten Fehlgeburt war die Woche von der
Diagnose bis zur Operation sehr wichtig und auch hilfreich, weil ich mich,
nachdem sich der Schock gelegt hatte, bewusst von meinem Bauchbaby
verabschieden konnte. Letztendlich war es ja dann auch meine Entscheidung ins
Krankenhaus zu gehen und die Operation machen zu lassen, eben weil meine
Blutwerte nicht mehr o.k. waren. Die Zeit bis zur Ausschabung war eigentlich
sehr friedvoll.“ Auch Regina M. hat sich bei ihrem zweiten Verlust mehr
Zeit gegönnt: „Nachdem ich realisiert hatte, dass es doch ein zweites
Mal passiert war, habe ich mir den Termin im Krankenhaus geholt und mir noch
zwei Tage mit *Noemi ‚gegönnt’ - in
dieser Zeit habe ich aktiv Abschied genommen. Ultraschall-Bilder in ein
Tagebuch geklebt, den ‚Sockenstrampler’
mit den 40 Söckchen für die 40 Schwangerschaftswochen - von denen mein Mann
jede Woche einen ‚Brief aus dem Bauch’ bekommen sollte - in eine
Erinnerungskiste gelegt, zusammen mit dem Schmusetuch, das ich voller Vorfreude
gekauft hatte. Und ich habe im Internet gesucht, nach häufigen Fehlgeburten, fand
die Seite der Schmetterlingskinder und habe nächtelang davor gesessen und um
all die Sternenkinder geweint. Doch waren es ‚heilsame Tränen’, weil sie mir
auf meinem Weg durch die Trauer weitergeholfen haben.“
Allerdings waren trotzdem mehr als 60% der Frauen zum gegebenen Zeitpunkt froh, einen Schlussstrich ziehen zu können, auch wenn sie nur sehr wenig Zeit bis zur Operation hatten. Betrachtet man die Gruppe von Frauen separat, die sich bewusst für eine Operation entschieden haben – und nicht nur, weil sie keine Alternative kannten – so fällt folgendes auf: - 74 Prozent dieser Frauen gaben an, genug Zeit gehabt zu haben, sich mit der Situation auseinander zu setzen; - 63 Prozent hatten genug Zeit, Abschied zu nehmen; - 70 Prozent waren froh, einen Schlussstrich ziehen zu können. Das heißt, dass diese Gruppe in allen drei Belangen weit über dem Durchschnitt der Gruppe aller operierten Frauen liegt, es ihnen also damit insgesamt schon vor dem Eingriff psychisch besser ging. Die Zeit zwischen der Diagnose und dem Eingriff beschreiben betroffene Frauen wie folgt: - Trauer, Verzweiflung, - bewusstes Abschiednehmen vom Kind, - Schock, schlimm, wie im Nebel, unwirklich, überrollt, nicht ernstgenommen, hilflos, - Schuldgefühle, - zu lang, wollte Operation schneller, - Angst, totes Kind zu tragen, - Angst vor unbekannter Situation, Operation, - körperlich elend, Krämpfe, Blutungen, Schmerzen, - schrecklich, unvorbereitete kleine Geburt. Besonders erschreckend ist, dass einige Frauen
völlig unvorbereitet die Zeit bis zur Operation durchleben mussten. Sabine
H. hat die Zeit angstvoll erlebt, „da ich nicht wusste, was mich erwartet.“
Die Frauen wurden auch nicht darüber aufgeklärt, dass die kleine Geburt
jederzeit einsetzen kann, was für sie ein großer Schock war. Leena: „Ich
habe mein Baby in der Nacht nach der Diagnose zu Hause verloren. Das war
unvorbereitet für mich, weil ich damals der Empfehlung meines Arztes gefolgt
wäre, eine Ausschabung machen zu lassen.“ Auch Sabine H. hat es
unvorbereitet getroffen: „Bald setzten Krämpfe (Wehen) ein, und ich bekam eine
starke Blutung, die mir sehr viel Angst machte und die eigentlich für den
nächsten Tag vorgesehene Operation
sofort nötig machte.“ Und Janna fragt sich: „Am nächsten Morgen sind wir
dann ins Krankenhaus gefahren. Dort bekam ich ein Zäpfchen gelegt, das den
Muttermund weich machen und öffnen sollte. Tja, da lag ich dann in dem Zimmer,
wissend, dass sie mir mein Kind bald wegnehmen. Irgendwann habe ich dann
Blutungen bekommen und wurde schnell in den Operationssaal gebracht -
inzwischen frage ich mich warum, man hätte es ja abbluten lassen und nur
bei Bedarf eine Ausschabung machen können.“ Bei den allermeisten Frauen verlief der Eingriff ohne Komplikationen. Allerdings litten über ein Viertel der Frauen unter sehr starken Schmerzen. Zum Teil bedingt durch die muttermundöffnenden Zäpfchen oder eine schlecht gesetzte spinale Narkose, zum Teil als nachoperative Schmerzen, Nachwehen oder durch Gebärmutterverletzungen. Insgesamt zehn Frauen (19%) hatten aufgrund der Operation körperliche Probleme. Während der Operation traten Atem- und Herzprobleme auf, nach dem Eingriff gab es Gebärmutterverletzungen, Entzündungen, hohe Blutverluste und Kreislaufprobleme. Langfristig löste sich bei einer Mutter bei der Folgegeburt der Mutterkuchen nicht, was auf die Ausschabung zurückgeführt wurde. Viermal (8%) musste nachoperiert werden. Für andere war die Operation eine körperliche Erleichterung. Regina M. hat dies so erlebt: „Durch die Operation und danach hatte ich keine Schmerzen, im Gegenteil, sie beendete die starken Schmerzen von den Krämpfen davor und war dadurch in gewissem Sinne erleichternd (zumindest körperlich).“ Die postoperativen Nachblutungen hielten zwischen sechs Stunden und sechs Wochen an, mit einem Schnitt von neun Tagen, wobei die Stärke sehr unterschiedlich war. Die Hälfte der Frauen hatte schwächere Blutungen als bei einer normalen Periode, ein Viertel hatte stärkere bis sehr starke Blutungen, bei etwa 14 Prozent war die Blutung einer Periodenblutung vergleichbar. Bei den anderen, meist lange anhaltenden Blutungen, ging eine anfangs starke Blutung später in eine normale oder schwache Blutung über. 41 Prozent der Mütter gaben an, durch die Operation seelische Probleme bekommen zu haben. Als Gründe wurden genannt: - Angst vor der Narkose, - Angst vor Unfruchtbarkeit, - Gefühl, dass das Kind gewaltsam entrissen worden war, - brutaler, fremdbestimmter Eingriff, - zu schnelle Operation. Für Maja dagegen war die Operation in der elften Schwangerschaftswoche eine große Erleichterung gewesen. „Ich hatte ja auch solche Schmerzen vorher und dazu diese Vorstellung, mein Kind stückchenweise zu verlieren, ich bin nach der Operation aufgewacht und hatte wenigstens diese Krämpfe nicht mehr und war körperlich sehr schnell wieder fit.“ Auch hier wird deutlich, dass die Frauen, die eine bewusste Entscheidung für die Operation getroffen haben, anschließend weniger psychische Probleme hatten als diejenigen, denen die Operation mehr oder weniger auferlegt wurde: - Nur 30 Prozent – im Gegensatz zu 52 Prozent – gaben an, anschließend wegen der Operation seelische Probleme bekommen zu haben und - für 81 Prozent war auch im nachhinein die Operation der für sie richtige Weg zur Schwangerschaftsbeendigung gewesen, im Vergleich zu 54 Prozent. Nur eine Mutter hat ihr Kind nach der Operation gesehen und durfte es sogar mit nach Hause nehmen und beerdigen. Sie ist sehr froh darüber, es war der richtige Weg für sie und entsprach ihrem Wunsch. Leider war es für 40 Prozent der Frauen, die ihr Kind nicht gesehen haben, nicht der richtige Weg. 42 Prozent der Mütter wissen nicht, was mit ihrem Kind nach der Operation geschehen ist. Sechs Babys (13%) wurden bestattet. Der Rest der Kinder wurde, zum Teil nach einer histologischen oder genetischen Untersuchung, klinisch entsorgt. Doch für die meisten Frauen (61%) wäre es wichtig gewesen, das Kind beerdigen zu dürfen. Einige hätten ihr Baby auch gerne gesehen und von ihm Abschied genommen. Weitere hätten sich eine genetische Untersuchung gewünscht oder gerne das Geschlecht ihres Kindes erfahren. Die erste Periode nach dem operativen Eingriff setzte nach 24 bis 84 Tagen ein, mit einem Durchschnitt von 39 Tagen. Sie war in einigen Fällen später, stärker, länger und schmerzhafter als normalerweise. Bei zwei Frauen traten nach der Operation auch Zyklusunregelmäßigkeiten auf. Allerdings war auch bei zehn Frauen (29%) diese erste Folgeperiode genauso wie zuvor.
60 Prozent der Frauen sind nach dem Verlust wieder schwanger geworden. Und zwar innerhalb eines Zeitraums von einem Monat bis drei Jahren (Schnitt: sieben Monate). 15 Kinder sind davon gesund zur Welt gekommen, drei waren zum Zeitpunkt der Befragung noch unterwegs. 13 Frauen (41%) erlitten leider wieder einen frühen Verlust, ein Kind starb wegen Fehlbildungen wenige Tage nach der Geburt. 67 Prozent der befragen Frauen sagten, dass die Operation für sie der richtige Weg zur Beendigung ihrer Schwangerschaft gewesen sei. Aber 54 Prozent denken auch, dass sie bei einer nochmaligen frühen Fehlgeburt nicht mehr ins Krankenhaus gehen würden. Gründe hierfür formulieren die Mütter zum Beispiel wie folgt: Sie haben (wieder) Vertrauen in ihren
Körper: - Sabine Ho.: „Mein Körper hat schon drei Mal bewiesen, dass er weiß, was er tun muss. Darauf würde ich wieder vertrauen.“ (Sabine hatte sich beim vierten Verlust für eine Operation entschieden, um eine genetische Untersuchung vornehmen zu lassen.) - Martina: „Da ich nach der Kürettage dieselben starken Blutungen und Krämpfe hatte, frage ich mich, wozu ich sie hatte?“ - Simone D. sagt: „Ich hätte einfach nur das Gefühl, mit meinem Körper natürlicher umgegangen zu sein.“ Sie wollen ihr Kind in Ruhe und Würde gehen
lassen: - Regina M. sagt: „Ich würde mir die Zeit nehmen, mein Kind gehen zu lassen, unter der Voraussetzung, dass ich die Schmerzen ertrage oder ich die Schmerzen durch Schmerzmittel dämpfen kann.“ - Auch Miriam „möchte bewusst Abschied nehmen können und die Zeit dafür haben.“ - Sandra erklärt: „Ich würde warten und meinem Baby die Würde geben wollen, die es verdient und es nicht entfernen lassen wie einen lästigen Fremdkörper.“ Sie glauben, dass es für sie seelisch
besser wäre: - Sonja: „Ich glaube, dass eine kleine Geburt zu Hause fürs Abschiednehmen besser ist, und falls es Komplikationen gibt, muss man sowieso ins Krankenhaus fahren.“ - Regina B. glaubt heute „...mit einer kleinen Geburt besser umgehen zu können. Ich würde mein Kind gerne beerdigen können und es sehen wollen.“ Sie haben unter der Krankenhausatmosphäre
gelitten: - Inka würde nach Möglichkeit nicht wieder ins Krankenhaus gehen, weil sie sich dort alleine und ausgeliefert gefühlt hat. „Ich musste etwas mit mir geschehen lassen, was ich nicht wirklich wollte.“ - Heike litt sehr unter der Situation im Krankenhaus: „Ich fühlte mich so herabgesetzt behandelt. Man ging überhaupt nicht auf mich, auf meine seelische Situation ein. Man legte mich auf ein Zimmer mit einer Schwangeren...“ Sie würden selber entscheiden wollen: - Natalie sagt: „Heute wäre ich gelassener und würde mich nicht mehr überreden lassen etwas zu tun, was ich nicht will.“ - Judith würde auf jeden Fall nicht mehr so schnell ins Krankenhaus gehen. Sie würde sich Zeit nehmen, denn sie sagt: „Heute weiß ich über das Thema mehr, weil ich die Alternativen zur Operation, die Trauer und meine Rechte besser kenne.“ - Katja betont: „Wichtig ist für mich eigentlich nur, dass ich die Möglichkeit habe, mich selbst zu entscheiden...“ Die meisten Frauen, die nicht wieder ins Krankenhaus gehen würden, glauben auch, dass eine kleine Geburt ihnen weniger seelische Probleme bereitet hätte als die Operation. Aber gleichzeitig denken sie, dass die Operation körperlich für sie in Ordnung war und einige von ihnen würden bei einer kleinen Geburt sogar mit mehr körperlichen Problemen rechnen. Sandra fasst das
so zusammen: „Körperlich kann ich nicht sagen, ob es einen Unterschied für mich
geben würde. Aber eine kleine Geburt hätte mir bestimmt geholfen zu verstehen,
dass mein Baby wirklich gestorben ist und mein Körper es nun los gelassen hat.
Nach der Operation habe ich mich immer gefragt, ob es sein kann, dass die Ärzte
sich geirrt haben und mein Baby noch gelebt hat. Ich habe nicht mitbekommen,
dass mein Baby fort war und nichts davon gespürt. Ich wollte es gehen sehen und
mich richtig verabschieden.“ Die Frauen, die wahrscheinlich bei einer nochmaligen Fehlgeburt wieder ins Krankenhaus gehen würden, begründen dies damit, - dass sie glauben, durch eine kleine Geburt mehr seelische und körperliche Probleme erleiden zu müssen; - dass sie schon eine „incomplete abortion“ hatten und merkten, das eine kleine Geburt „nicht ihr Weg“ ist; - dass sie eine kleine Geburt zuhause nicht durchmachen möchten; - dass sie innerlich dafür nicht bereit wären; - dass sie sich wieder richtig gesund fühlen wollten oder - sich, wie Christina, unter Druck fühlten, „weil ich schon über drei Wochen nicht arbeiten konnte und überhaupt nicht absehbar war, wann das hätte passieren können.“ Die betroffenen Frauen wünschen sich folgende Themen, die vom behandelnden Frauenarzt nach einer Fehlgeburt angesprochen werden sollten: Der psychische Aspekt: - fragen, wie es einem geht; - psychische Hilfe anbieten; - Zuspruch/ Recht zu trauern/ Beileid aussprechen; - den Partner mit einbeziehen; - auf Selbsthilfegruppen, Foren, Trauergruppen, Bücher und Infoblätter aufmerksam machen; - Bestattungsmöglichkeiten nennen. Christiane schreibt hierzu: „Der Frauenarzt hat nur das Medizinische gesehen. Wichtig für mich wäre es gewesen, mir zu erklären, dass ich nicht schuldig bin, an wen ich mich in meiner Not wenden kann, wer mich auffängt in meinem Schmerz.“ Dieser Unmut spiegelt sich auch darin wieder, dass sich nur knapp 40% der befragten Frauen von ihrem Arzt in ihrer Trauer verstanden gefühlt haben. Viele Frauen hätten sich mehr Verständnis für ihre Trauer gewünscht, dass auf ihre seelische Verfassung mehr eingegangen wäre und ihrem toten Kind mehr Respekt entgegengebracht worden wäre. Auch sollte ausdrücklich auf Bestattungsmöglichkeiten hingewiesen werden. Nur sechs aller befragten Frauen wurden von ihren Ärzten auf Selbsthilfegruppen, Foren oder ähnliches aufmerksam gemacht. Der körperliche Aspekt: - Ursachenforschung/genetische Untersuchung anbieten (evtl. auf eigene Kosten); - mögliche Beschwerden nach einer Fehlgeburt nennen; - körperliche Beschwerden in Betracht ziehen/ Krankschreibung; - Nachsorge mit Hilfe von Ultraschall und hCG-Wert-Bestimmung; - Anspruch auf Hebamme; - Rückbildungskurse anbieten. Im Zusammenhang mit einer Folgeschwangerschaft liegt vielen Frauen insbesondere die Ursachenforschung am Herzen. Außerdem stellen sich den Frauen Fragen wie: - Wie lange sollte man bis zur nächsten Schwangerschaft warten? - Wie groß ist die Gefahr, wieder eine Fehlgeburt zu erleiden? - Vorbeugungsmaßnahmen? Während der Folgeschwangerschaft hätten sich viele Frauen mehr Verständnis für ihre Ängste gewünscht. Einig scheinen sich die Mediziner bei der Frage zu sein, wann Geschlechtsverkehr wieder erlaubt ist. Die meisten sagten „nach Ende der Blutungen“. Wenig Einigkeit dagegen scheint über die Frage des frühesten Zeitpunkt einer Folgeschwangerschaft zu bestehen. Hier schwanken die Angaben zwischen sofort bis zu sechs Monaten - bei Muttermundverletzung sogar bis zu einem Jahr. Sehr viele Ärzte empfahlen drei Monate Wartezeit, andere überließen es aber auch ausschließlich dem Gefühl der Frau. Im folgenden werde ich die einzelnen Wege miteinander vergleichen, eine nicht mehr intakte Schwangerschaft zu beenden, die Ergebnisse diskutieren und anschließend die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einbeziehen. Spontane und abgewartete kleine Geburt Da es sich in beiden Fällen um kleine Geburten handelt, war anzunehmen, dass sich die körperlichen Erlebnisse der Frauen sehr ähneln. Psychisch handelt es sich natürlich um ganz unterschiedliche Erfahrungen. Der
physische Vergleich Die meisten spontanen kleinen Geburten ereigneten sich in der sechsten Schwangerschaftswoche, wohingegen die meisten abgewarteten Geburten in der zehnten Woche passierten. Dies hängt sicherlich mit dem Zeitpunkt des ersten Arztbesuches zusammen, denn die meisten Frauen hatten ihren ersten Arztbesuch nicht vor der sechsten Woche, sondern zwischen der neunten und zwölften Woche, wobei die Kinder zum Teil schon seit bis zu zwei Wochen tot waren. In beiden Gruppen konnte ein Zusammenhang zwischen der Stärke der Schmerzen und der Blutungen abhängig von der Schwangerschaftswoche festgestellt werden.
Allerdings wurden die Schmerzen bei den spontanen kleinen Geburten insgesamt stärker empfunden als bei der abgewarteten. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Frauen bei einer abgewarteten kleinen Geburt sich bewusst für diesen Schritt entschieden haben und daher darauf vorbereitet waren. Eine spontane kleine Geburt dagegen ist gleichzeitig noch mit einem Schock verbunden. Insgesamt kam es bei beiden Gruppen zusammen
nur zu einer Notoperation – wegen starker Blutungen.
Der Abgang von Gewebestücken dauerte bei den
abgewarteten kleinen Geburten im Schnitt sieben Tage länger. Insgesamt kann man
daher mit einer durchschnittlichen Dauer von vier bis fünf Tagen rechnen. Man
kann hier aber keinen Zusammenhang zwischen der Dauer und der
Schwangerschaftswoche erkennen. Die Nachblutungen waren bei beiden Gruppen
gleich lange und stark. Sie können bis zu drei Wochen andauern, im Schnitt
waren es sieben bis zehn Tage. Bemerkenswert ist, dass bei allen abgewarteten
kleinen Geburten diese anschließend als „vollständig“ gewertet wurde und keine
Nachoperation erfolgte, wohingegen 35 Prozent der spontanen kleinen Geburten
als „unvollständig“ galten und in sechs von sieben Fällen sich noch eine
Kürettage anschloss. Dies ist vermutlich auf die unterschiedliche innere
Einstellung der Frauen der beiden Gruppen zurückzuführen. Die eine Gruppe war
geschockt von der plötzlichen Geburt und ist daraufhin sofort zum Arzt
gegangen, der die Frauen umgehend ins Krankenhaus schickte. Dagegen konnte sich
die andere Gruppe auf die Geburt einstellen, wollte sie auch zu Ende führen und
hat erst einmal mit der Nachuntersuchung gewartet. Es ist also anzunehmen, dass zumindest einige
der spontanen kleinen Geburten noch „vollständig“ geworden wären, hätten die
Frauen Zeit gehabt, die kleine Geburt weiterzuführen. Außerdem gibt es bei beiden Gruppen den
Hinweis darauf, dass für die endgültige Diagnose über die Vollständigkeit bis
nach der ersten Folgeperiode abgewartet werden sollte. Das heißt, dass vermutlich die Entscheidung
über den Grad der Fehlgeburt wesentlich vom Faktor Zeit abhängt. Es traten insgesamt geringe körperliche
Probleme auf. Genannt wurden: -
stärkere Folgeperioden, -
die Periode kam nicht zurück, -
Gebärmutterkrämpfe, -
schmerzende Dammnarbe, -
starkes Schwitzen, -
Müdigkeit, -
niedriger Blutdruck mit Schwindel. Auch die erste Folgeperiode verlief bei beiden
Gruppen gleich. Etwa 63 Prozent der Frauen waren nach einer
kleinen Geburt innerhalb von vier bis fünf Monaten wieder schwanger geworden.
Leider mussten insgesamt 48 Prozent der Mütter erneut einen Verlust erleiden. Der psychologische
Vergleich Alle Mütter waren froh gewesen, wenn sie ihre
Kinder gesehen und beerdigt hatten. Gerne hätten es noch mehr so erlebt.
Insbesondere den abwartenden Frauen sollte hierzu der Hinweis gegeben werden,
dass sie sich darauf vorbereiten sollten, ihr Kind bei der Geburt aufzufangen,
z.B. mit einem Sieb über der Toilettenschüssel oder direkt in eine
Auffangschale. Es gibt gravierende Unterschiede in der
seelischen Belastung durch die kleine Geburt. Fast alle Mütter hatten nach der
spontanen kleinen Geburt seelische Probleme, wohingegen die Mütter, die auf die
Geburt gewartet haben, sehr gut mit der Belastung umgehen konnten. Sie hatten Zeit gehabt, sich mit der Situation auseinander zu setzen
und sich von ihrem Kind zu verabschieden. Ausnahmslos alle Mütter der beiden Gruppen
würden, falls sie die Wahl hätten, bei einer weiteren Fehlgeburt auf eine
kleine Geburt warten wollen. Sie -
vertrauen ihrem Körper, -
möchten sich in Ruhe und Würde von ihrem
Kind verabschieden, -
denken, es wäre seelisch leichter, -
möchten nicht ins Krankenhaus. Abgewartete kleine Geburt und operativer Eingriff Bei diesem Vergleich waren die größten
Unterschiede zu erwarten, sowohl körperlich als auch seelisch. Was führt dazu, dass Frauen den Weg der
abgewarteten kleinen Geburt oder des operativen Eingriffs gehen? Es wird ganz deutlich, dass auf die kleine
Geburt in der Regel auf Wunsch der Mutter gewartet wird, die Operation aber auf
Grund fehlender Informationen zu 50 Prozent fremdbestimmt ist. Das bringt
natürlich eine ganz unterschiedliche innere Einstellung mit sich, denn es ist
allen Frauen, egal welchen Weg sie gehen wollen, sehr wichtig, selbst die
Entscheidung zu treffen. Katja drückt dies so aus: „Körperlich, denke
ich, gäbe es für mich keinen Unterschied. Seelisch wäre eine Operation nur in
Ordnung gewesen, wenn ich mich selber dazu entschlossen hätte.“ Außerdem scheint die Erfahrung einer
vorangegangenen Geburt wichtig für die Entscheidung zur abgewarteten Geburt zu
sein. Denn 61 Prozent der Frauen, die diesen Weg bewusst wählten, hatten zuvor
schon Kinder zur Welt gebracht, aber nur 42 Prozent der Frauen, die eine
Operation hatten vornehmen lassen. Daneben gibt es noch eine Reihe von Gründen,
die für den einen oder anderen Weg sprechen: -
Angst vor dem Krankenhaus/der
Operation; -
Wissen, dass es nicht so risikoreich
ist, wie die Ärzte gerne behaupten; -
organisatorische Probleme; -
Wunsch, der Natur freien Lauf zu
lassen; -
Wunsch, sich in Ruhe, in Würde und in
Liebe von dem Kind zu verabschieden und es sehen zu können. -
Angst vor der kleinen Geburt; -
Arzt hatte vor der kleinen Geburt
gewarnt; -
Operation kontrollierbarer/planbarer; -
Angst, Kind an „unpassendem“ Ort zu
verlieren; -
starke Blutungen und Schmerzen schon
bei Diagnose; -
kein totes Kind tragen zu wollen; -
sich schnell wieder gesund fühlen
wollen; -
es schnell hinter sich bringen
wollen/Neuanfang/Schlussstrich; -
psychische Belastung. Welche körperlichen Unterschiede gibt es? Wie zu erwarten, gibt es keine wesentlichen
Unterschiede im Zeitpunkt des Schwangerschaftsverlustes. Beide Gruppe erleiden im Schnitt in der zehnten
Schwangerschaftswoche ihren Verlust, kurz nach ihrem ersten Arztbesuch. In der Regel sind auch alle Mütter ausreichend
über mögliche Komplikationen und Risiken ihres Weges informiert: -
zu lange, zu starke
Blutungen/Kreislaufprobleme, -
starke Schmerzen -
Fieber, Infektionen, -
Plazentareste/incomplete abortion/Nachoperation, -
Verkleben der Eierstöcke/Infertilität, -
psychische Belastung. -
Verletzungen der Gebärmutter, evtl.
Entfernung der Gebärmutter nötig, -
Verletzung des Muttermundes,
Muttermundschwäche, -
Verletzung nebenliegender Organe, -
starke Blutungen, -
Infektionen, -
Gewebereste, Nachoperation, -
Infertilität, -
Narkoserisiken, -
psychische Belastung. Mittlere bis starke Schmerzen traten bei den
kleinen Geburten etwas häufiger auf (ca. 33%) als bei den Operationen (ca. 25%). Allerdings wurden diese nach den Operationen meist schnell durch
Schmerzmittel bekämpft. Auch Müttern, die auf eine kleine Geburt warten,
sollten Schmerzmittel zur Verfügung gestellt werden! Die Nachblutungen verliefen in beiden Gruppen
ähnlich. Sie dauerten nach der kleinen Geburt im Schnitt zehn Tage (3 bis 21
Tage), und nach der Operation durchschnittlich neun Tage (0 bis 42 Tage). Nachblutungen scheinen nach
der kleinen Geburt etwas stärker zu sein. Nachfolgende körperliche Probleme gab es in
beiden Gruppen etwa gleich selten, waren aber nach den kleinen Geburten
wesentlich milder. Es wurden genannt: Körperliche
Probleme nach der kleinen Geburt (17%) Körperliche
Probleme nach dem operativen Eingriff (19%) -
für zwei Monate stärkere Periode; -
schmerzende Dammnarbe; -
starkes Schwitzen für sechs Wochen. -
Gebärmutterverletzungen; -
Entzündungen; -
hoher Blutverlust/Kreislaufprobleme; -
Nichtablösen des Mutterkuchens bei
Folgeschwangerschaft; -
Zyklusprobleme. In acht Prozent der Fälle musste nach der
Kürettage noch einmal operiert werden, in keinem Fall nach der kleinen Geburt.
Allerdings haben sich zwei Frauen während des Wartens wegen körperlicher oder seelische Probleme später
doch noch zu einer Operation entschlossen. Der Verlauf der ersten Folgeperiode war bei
beiden Gruppen etwa gleich. Nach der kleinen Geburt setzte sie im Schnitt nach
32 Tagen ein, nach der Operation nach 39 Tagen. Dass sie nach dem operativen
Eingriff häufiger verzögert beginnt, ist evtl. darauf zurückzuführen, dass der
Körper hierbei ja erst einmal „merken“ muss, dass die Schwangerschaft beendet
ist. Wohingegen er bei der kleinen Geburt die Schwangerschaft selbst beendet
und die Hormone schon zum Zeitpunkt der Geburt nicht mehr auf Schwangerschaft
eingestellt sind. In beiden Gruppen waren nach vier bis sieben
Monaten 60 Prozent der Frauen wieder schwanger. Leider haben 34 (nach kleiner
Geburt) bis 41 Prozent (nach Operation) der Mütter ihr Kind wieder in der
Frühschwangerschaft hergeben müssen. Vergleich der psychischen Aspekte Wie schon im
allgemeinen Teil und im Kapitel über den operativen Eingriff herausgestellt,
scheint der Faktor „Zeit“ bei der seelischen Verarbeitung eines
Schwangerschaftsverlustes eine wesentliche Rolle zu spielen. Es sollte den
Frauen, solange kein Notfall vorliegt, wenigstens drei Tage Zeit zur Auseinandersetzung
mit der Situation und zum Abschiednehmen vom Kind angeboten werden. Nach diesen
drei Tagen hatten auch die Frauen, denen eine Operation bevorstand, das Gefühl,
genug Zeit dafür gehabt zu haben. Die meisten Frauen, die auf eine kleine
Geburt warteten, hatten in dieser Zeit die Gelegenheit, sich von ihrem Kind zu
verabschieden und den Trauerprozess zu beginnen. Frauen, die eine kleine Geburt erlebten,
sagen, dass sie dadurch keine seelischen Probleme erlitten. Sie glauben z.T.
sogar, dass es ihrer Psyche gut getan habe, sich auf diese Weise von ihrem Kind
verabschiedet zu haben. Dagegen gaben 41 Prozent der Frauen, die eine Operation
hatten, an, seelische Probleme bekommen zu haben. Sie nannten folgende Gründe
hierfür: -
Gefühl, dass das Kind gewaltsam entrissen
worden war, -
brutaler, fremdbestimmter Eingriff, -
zu schnelle Operation. Für andere war die Operation aber auch eine
große Erleichterung, da sie keine Schmerzen mehr erleiden wollten und einen
schnellen Neubeginn erhofften. Die Tage der Wartens haben die beiden Gruppen
so erlebt: -
Trauer, -
bewusstes Abschiednehmen, -
schlechter Traum, Ausnahmezustand, sehr
schrecklich, schlimme Zeit, wie im Strudel, -
Zweifel, Angst, Verzweiflung, -
organisierend, vorbereitend. -
Trauer, Verzweiflung, -
bewusstes Abschiednehmen vom Kind, -
Schock, schlimm, wie im Nebel,
unwirklich, überrollt, nicht ernst genommen, hilflos, -
zu lange Wartezeit auf die Operation, -
Angst, totes Kind zu tragen, -
Angst vor unbekannter Situation,
Operation -
körperlich elend, Krämpfe, Blutungen,
Schmerzen, -
schrecklich, unvorbereitete kleine Geburt Bei der kleinen Geburt ist die Chance, das
Kind zu sehen, wesentlich höher als nach der Operation. Doch vielen Frauen
beider Gruppen wäre es wichtig gewesen, ihr Baby zu sehen und auch beerdigen zu
können. Da ist es gut zu sehen, dass es immer mehr Frühchengrabfelder gibt, und
die Gesellschaft dieses Anliegen mehr und mehr akzeptiert. Eltern, die in der
frühen Schwangerschaft ein Kind verlieren, sollten sich rechtzeitig bei der
Gemeinde und evtl. dem Krankenhaus über die Möglichkeit der Beisetzung
informieren. Vergleich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen Zur Definition der frühen Fehlgeburt Beim Vergleich von Theorie und Praxis sind zwei
Diskrepanzen festzustellen: 1. Bis wann von einer „frühen Fehlgeburt“
gesprochen wird. Diese Entscheidung zieht auch die Frage der
Behandlungsmöglichkeiten nach sich (siehe weiter unten „Sonderfälle“). Da in
der Literatur von einen „Abort bis zur 16. Schwangerschaftswoche“ gesprochen
wird, habe ich auch für die Auswertung hier den Schnitt gezogen. Allerdings
scheint in der Praxis dieser Schnitt nicht so deutlich zu sein, da sowohl z.T.
schon vor der 16. Woche von einer Kürettage abgesehen wird, als auch z.T.
danach noch Operationen durchgeführt werden. 2. Wann von einer „missed abortion“ gesprochen
wird. Die Literatur spricht vom „frühen fötalem Tod, ohne dass Blutungen oder
Krämpfe auftreten“[i]. Früher
musste dieser Zustand über mindestens acht Wochen bestehen, durch die
Sonographie wurde die Diagnose auf ein paar Tage reduziert. Dies führte auch zu
einem sprunghaften Anstieg der Diagnose. Trotz der Definition über das „Ausbleiben von
Blutungen oder Krämpfen“ war bei vielen Frauen, die schon mit Blutungen zur
Untersuchung kamen, eine „missed abortion“ diagnostiziert worden. Außerdem ist anzunehmen, dass ohne frühzeitige
Sonographie sich aus den 75 Prozent stiller Fehlgeburten mehr spontane kleine
Geburten entwickelt hätten. Allerdings scheint eine kleine Geburt psychisch für
die Mutter besser zu verkraften zu sein, wenn sie sie erwartet hatte (vgl.
„Spontane und abgewartete kleine Geburt“), was wiederum für eine frühe Diagnose
spricht. Zur Behandlung von stillen Fehlgeburten Leider scheint das Dogma, „dass nach der
Diagnose einer frühen Fehlgeburt die Uterushöhle möglichst rasch und komplett
mittels Abortkürettage chirurgisch entleert werden muss“[ii]
bei vielen Ärzten auch heute noch Bestand zu haben. Denn in der Umfrage wurden
67 Prozent der betroffenen Frauen nur über diesen Weg aufgeklärt. Medizinischer Vergleich von Kürettage und
abwartendem Verhalten Die Ergebnisse der Umfrage stimmen mit den
Ergebnissen der wissenschaftlichen Untersuchungen gut überein. nach
21 Tagen Wissenschaft, Durchschnitt 81% 98% Umfrage 79% 92% Außerdem wurde insgesamt festgestellt, dass
Blutungen bei der Erstuntersuchung auf eine relativ schnelle spontane
Beendigung der Schwangerschaft hinweisen. Allgemein dauern die Nachblutungen nach einer
kleinen Geburt etwas länger als nach einer Operation. Sowohl bei den wissenschaftlichen
Untersuchungen als auch bei der Umfrage stellt sich heraus, dass der Anteil der
schwerwiegenden Komplikationen bei beiden Gruppen gering ist. Quelle abwartendem
Verhalten Kürettage Infek-tionen Excessive Blutungen/ Transfusion Perforation, Gebär- mutterriss Total Infek-tionen Excessive Blutungen/ Transfusion Perforation, Gebär-mutterriss[A13] Total Wissenschaft, Durchschnitt 2% 4% 2% 4% 7% 3% 2% 7% Umfrage 7% 0% 0% 7% 6% 0% 4% 10% Auch für Folgeschwangerschaften gibt es keine
signifikanten Unterschiede zwischen den Methoden der
Schwangerschaftsbeendigung. Frauen werden etwa gleich häufig und schnell wieder
schwanger und haben gleichen Chancen, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Wie schon in der wissenschaftlichen Literatur
aufgezeigt, ist es auch den Frauen der Umfrage besonders wichtig, selbst über
den Weg der Schwangerschaftsbeendigung entscheiden zu können. Außerdem haben
sie in der Regel eine starke Präferenz für den einen oder anderen Weg, wobei
der Wunsch zu Gunsten des abwartenden Verhaltens tendiert. Insbesondere Frauen, die schon mal eine kleine
Geburt erlebt haben, würden diesen Weg wieder wählen, aber auch nach einer
Operation würden 47 Prozent der Frauen beim nächsten Mal eine abgewartete
kleine Geburt vorziehen. Auch die Erfahrung einer normalen Geburt oder
einer schon erlebten Fehlgeburt trägt zur positiven Entscheidung für die kleine
Geburt bei. Aber auch die Empfehlung des Arztes
beeinflusst die Entscheidung wesentlich. Der psychologische Vergleich Die Umfrage konnte auch hier die
wissenschaftlichen Daten bestätigen, dass die freie Behandlungswahl die
psychische Verfassung wesentlich positiv beeinflusst und dass insgesamt die
abwartende Behandlung positiver für die Verarbeitung des Verlustes ist. Was zu beachten ist[A14] Wie schon im wissenschaftlichen Teil betont, wurde
auch durch die Umfrage deutlich, dass trotz der ermutigenden Ergebnisse über
die abgewartete kleine Geburt einige wichtige Dinge zu beachten sind:
1. Es ist sehr wichtig, dass
die Patientin über mögliche Symptome und den natürlichen
Hergang einer kleinen Geburt
aufgeklärt wird. Kati schreibt: „Gut begleitet wäre eine
kleine Geburt für mich möglicherweise besser gewesen.“ Hier ist es auch wichtig zu erwähnen,
dass auch bei der kleinen Geburt der Anspruch auf eine Hebammenbegleitung
besteht! 2.
Die Patientin sollte dringend dazu aufgefordert werden, zu jeder Zeit
medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, falls dies
notwendig wird. Es sollte also auch ein Krankenhaus in erreichbaren Nähe sein. Zur Nachsorge Bei der
Einteilung der Fehlgeburten in „vollständig“ und „unvollständig“ ist der Faktor
Zeit zu beachten. Zum einen kann es bis zu 60 Tage dauern (Schnitt 30 Tage),
bis der hCG-Wert wieder auf Null ist. Zum anderen kann – falls keine
Komplikationen auftreten – bis nach der ersten Folgeperiode gewartet werden, um
sicherzustellen, dass keine Gewebereste in der Gebärmutter verblieben sind. Neben der
medizinischen Nachsorge, die sich nur darauf beschränkt festzustellen[A15], ob die Fehlgeburt komplett ist, sind den Frauen der Umfrage vor allem
auch die Ursachenforschung und Aspekte zur Folgeschwangerschaft wichtig. Auch der
psychischen Nachsorge sollte mehr Beachtung geschenkt werden. Vor allem das
Recht zu trauern sollte den Eltern zugestanden werden. Hiermit verbunden
sollten psychische Hilfen angeboten, auf Selbsthilfegruppen, Foren u.a.
aufmerksam gemacht und auf Bestattungsmöglichkeiten hingewiesen werden. Welches ist der richtige Weg? Diese Frage kann natürlich nur jede Mutter für
sich selbst beantworten. Jede Frau ist anders und auch jede Situation. Für die
einen ist es eine reine Bauchentscheidung, die anderen gehen eher rational an
diese Frage heran. Wichtig ist nur, dass jede Frau die nötige Information über
alle möglichen Wege bekommt, um sich bewusst und kompetent entscheiden zu
können! Ich hoffe, mit dem Projekt „Mehr Aufklärung
bei frühen Verlusten“ einen kleinen Teil zu dieser Aufklärung beigetragen zu
haben. Die Frauen,
die sich an der Fragebogenaktion beteiligt haben, haben die Frage „des
richtigen Weges“ bei einem weiteren Verlust für sich so beantwortet: -
alle Mütter, die eine spontane kleine
Geburt erlebten, würden auf eine kleine Geburt warten wollen; -
alle Mütter, die eine abgewartete kleine
Geburt erlebten, würden diesen Weg wieder wählen; -
67 Prozent der Mütter, die eine Operation
vornehmen ließen, glauben zwar, dass dies in dem Moment für sie der richtige
Weg gewesen war, doch über die Hälfte aller würde in Zukunft eine kleine Geburt
vorziehen. Gründe, die im Nachhinein für eine kleine
Geburt sprechen sind folgende: -
Vertrauen in den eigenen Körper, -
das Kind in Ruhe und Würde gehen lassen
wollen, -
Glauben, dass es seelisch besser sei, -
Leiden unter der Krankenhausatmosphäre. Gründe, die im Nachhinein für eine
Operation sprechen sind folgende: -
Glauben, weniger seelische und
körperliche Probleme zu erleiden, -
Wissen, dass eine kleine Geburt nicht der
richtige Weg für sie ist, -
Wunsch, sich schnell wieder gesund zu
fühlen. Doch am wichtigsten ist es, die Möglichkeit zu
haben, sich selbst zu entscheiden! Zur Entscheidungshilfe vgl. auch
„Literaturrecherche und Entscheidungshilfe“. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||