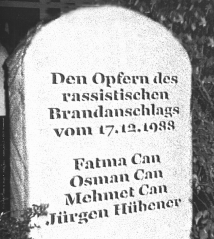 |
Gegen das Vergessen Bündnis gegen Rechts |
|
|
Jahreswechsel |
Streit in Schwandorf um die Form des Gedenkens an einen rassistischen Brandanschlag vor
zehn Jahren
Ein Mahnmal wird zum Stein des AnstoßesVerwaltung und CSU-Mehrheit im Stadtrat verweigern Erlaubnis, einen Gedenkstein für die Opfer aufzustellenVon Rolf Thym Schwandorf - Der Stein, der so viel Anstoß erregt in Schwandorf, wurde mit Bedacht ausgesucht: Er ist aus dunklem Passauer Granit - aus Passau deshalb, weil dort seit Jahren rechtsextreme Parteien, gegen das verzweifelte Bemühen der Stadt, in der Nibelungenhalle tagen. So sollte allein schon die Herkunft des kleinen Granitblocks ein Symbol sein, zumal da in ihn die Namen von vier Menschen eingemeißelt sind, die beim Brandanschlag eines jungen Schwandorfer Neonazis ums Leben gekommen sind. Doch der Stein darf nicht dort stehen, wo er nach dem Willen mancher Schwandorfer stehen soll: Die Verwaltung der oberpfälzischen Kreisstadt und die CSU-Mehrheit des Stadtrates verweigern seit vier Jahren hartnäckig die Erlaubnis, den als Mahnmal gedachten Stein auf einem schmalen, städtischen Grünstreifen am Schlesierplatz aufzustellen - genau an jener Stelle, an der vor zehn Jahren und knapp drei Monaten das Unfaßbare geschah. In der Nacht zum 17. Dezember 1988 schlich der damals 19 Jahre alte Lackiererlehrling Josef Saller in den Eingang des Eckhauses, wo sich Schwaigerstraße, und Schlesierplatz treffen. Saller wußte, daß überwiegend Ausländer in dem Haus lebten. Er zündete mit drei Streichhölzern einen Pappkarton an und verschwand. Das Treppenhaus ging in Flammen auf, und als die Feuerwehr zu retten suchte, wer noch zu retten war, fanden die Helfer die Leichen von vier Menschen, die qualvoll erstickt und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt waren. Dem Brandanschlag des jungen Neonazis -der rasch gefaßt und zu zwölfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde - fielen in jener Dezembernacht das türkische Ehepaar Fatma und Osman Can, deren zwölf Jahre alter Sohn Mehmet und der Deutsche Jürgen Hübener zum Opfer. Ihre Namen stehen nun auf dem Stein aus Passauer Granit und darüber die Worte: "Den Opfern des rassistischen Brand-Anschlages vom 17.12.1988". Josef Saller, ein feuriger Anhänger der Nationalistischen Front und Hitler-Verehrer, war damals der erste Rechtsextreme in Deutschland, der gezielt Feuer gegen Ausländer gelegt hatte. Sein Verbrechen ging bundesweit durch die Medien, und manchen Braunen gilt er bis heute als Held: Auf den Internet-Seiten des rechtsextremen Thulenetzes wird er in einer Liste der "Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene" geführt. Vier Monate nach dem Brandanschlag, der die Schwandorfer entsetzt hatte, verabschiedete der Stadtrat auf Antrag der SPD eine Resolution: Er verurteilte die "verbrecherische Aktion" des jungen Neonazis und distanzierte sich "von jeglicher Art ausländerfeindlichen Verhaltens". Aber nicht alle. Schwandorfer hielten dieses Bekenntnis für ausreichend: Die Stadträtin Irene Sturm zum Beispiel, ehemals Grünen-Landtagsabgeordnete und inzwischen parteilos, dachte zusammen mit Mitgliedern des bayernweit aktiven "Bündnisses gegen Rechts" darüber nach, wie der Toten des Brandanschlags am Schlesierplatz gedacht werden könne. Es entstand die Idee, die Stadt solle am Schauplatz des Verbrechens ein Mahnmal errichten. Irene Sturm schrieb an den Stadtrat einen Antrag, der jedoch mit Verweis auf die Geschäftsordnung von der Verwaltung behandelt und im Februar 1994 beantwortet wurde. Von einem "scheußlichen Verbrechen" war darin die Rede, von der "Tat eines Einzelgängers und politischen Wirrkopfes", und auch davon, "daß wir Schwandorfer mit unseren ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern friedlich und freundschaftlich zusammenleben wollen und können". Am Ende des Schreibens hieß es: "Die unbegreifliche Tat und die Toten werden den Schwandorfern in Erinnerung bleiben, eines Mahnmals bedarf es dafür nicht." Und dabei blieb es. Immer wieder gab es Versuche, den CSU-Oberbürgermeister Hans Kraus und seine CSU-Räte umzustimmen - zuletzt vor wenigen Tagen bei einer Sitzung des Stadtrates, der sich auf Antrag der SPD erneut mit der geforderten Aufstellung des steinernen Mahnmals zu befassen hatte. Den Stein gab es nämlich inzwischen schon: Aus Spenden war der Granitblock angeschafft und der Steinmetz für das Einmeißeln der vier Namen der Toten bezahlt worden. Das interessierte die CSU-Räte freilich herzlich wenig. Sie blieben bei ihrem harten Nein - mit bemerkenswerten Argumenten. Oberbürgermeister Kraus befand gleich zu Beginn der Debatte, die Stadt brauche "eine Wallfahrtsstätte für radikale Gruppen nicht" - welche Radikalen er meinte, sagte er nicht. Und der CSU-Fraktionsvorsitzende Uwe Kass erklärte, es könne nicht angehen, "Unterschiede bei Opfern von Gewaltverbrechen zu machen". Und wenn doch ein Mahnmal für die Toten des Neonazi-Brandanschlags errichtet werde, dann "müßte man" - so sagte Kass später gegenüber der Süddeutschen Zeitung - "für jedes Gewaltopfer ein Mahnmal errichten, absolut für jedes". Ihren Tiefpunkt erreichte die quälende Auseinandersetzung mit der Wortmeldung des Freie-Wähler-Stadtrates Hans Zilch: Er, der Monate zuvor noch für das Mahnmal eingetreten war, stieß sich nun plötzlich daran, daß der Name des deutschen Todesopfers auf dem Gedenkstein "nicht an erster Stelle" genannt ist. Das erinnerte manchen Zuhörer fatal an die Rechtsextremen-Parole: "Deutsche zuerst". Zusammen mit der CSU stimmte der Freie Wähler gegen das Mahnmal. Der Antrag wurde mit 16 zu 13 Stimmen abgelehnt. Die parteilose Stadträtin und Mahnmalinitiatorin Irene Sturm ist immer noch sichtlich fassungslos, wenn sie an den Verlauf dieser Sitzung zurückdenkt. Die Schwandorfer CSU-Fraktion spiele "mit dieser Diskussion ganz eindeutig den Rechtsradikalen in die Hände", sagt sie, "und bringt Schwandorf bundesweit in Verruf". So steht der graue Stein mit den Namen der vier Toten darauf also weiter im Hof eines kleinen Hauses, in dem Irene Sturm ihr Büro hat. Über dem Granitblock ist ein Plakat befestigt: "Dieser Stein wartet darauf, daß er von der Stadt fest am Schlesierplatz aufgestellt wird, wo er hingehört." Dort, wo die Familie Can und Jürgen Hübener starben, steht schon längst der Neubau eines Geschäftshauses - und auf dem schmalen Grünstreifen davor eine Telephonzelle. [Foto] SEIT VIER JAHREN bemüht sich die Schwandorfer Stadträtin Irene Sturm vergeblich darum, den bereits fertigen Gedenkstein auf städtischem Grund aufstellen zu lassen. Photo: Thym Süddeutsche Zeitung (Nr. 60, S. 64, Bayern) 13./14.03.1999 |