|
Inhalt
• Einleitung
• Ziele •
Psychologie
• Entwurf •
Style Guide
• Prototyp
• Ausblick
• Literatur
• Anhänge
2 Psychologische Aspekte der MCI
2.1 Informationsaufnahme des Menschen
Eine notwendige Grundlage für Oberflächenentwickler ist
das Verständnis für die kognitiven Fähigkeiten des Benutzers
(vgl. [Shne98] S. 20). Diese sind die Voraussetzung des Anwenders, um die
vom Anwendungssystem angebotenen Informationen aufzunehmen und zu
verarbeiten.
2.1.1
Informationsverarbeitung
Seit den sechziger Jahren wird in der Psychologie
versucht, Verhalten und Erleben des Menschen als Informationsverarbeitung
zu betrachten (vgl. [Glas94] S. 7ff). Dies wird durch die Nutzung der
Computermetapher ermöglicht. Die Hardware findet ihre Analogie im
physischen Organismus, dem Untersuchungsgebiet der Biologie und
Physiologie, die Software entspricht dem geistigen Geschehen im Menschen,
dem Gebiet der Psychologie. Die psychologische Grundlagenforschung
geschieht heute überwiegend im Rahmen dieses
Informationsverarbeitungsansatzes.
Auf dieser Basis wurde das Modell der Architektur der
menschlichen Kognition entwickelt (vgl. Abbildung 1). In diesem steht das
Individuum der Umwelt gegenüber. Die informationellen Einwirkungen der
Umwelt auf den Menschen werden unter dem Begriff Wahrnehmung subsumiert.
Sie stellen den Input für den Benutzer, d.h. gleichzeitig den Output eines
Softwaresystems dar. Dieser Bereich ist vor allem für die Gestaltung der
Benutzungsschnittstelle von Bedeutung (vgl. Abschnitt 2.1.2). Die
Verarbeitung der Informationen im Exekutivsystem wird mit Hilfe des
Gedächtnissystems realisiert. Dieses arbeitet unter Nutzung von mentalen
Modellen. Sie sind für die Struktur einer Benutzungsschnittstelle von
entscheidender Bedeutung (vgl. Abschnitt 2.2). Das Gedächtnissystem greift
auf das Kurz- und Langzeitgedächtnis zurück. In verschiedenen Arbeiten
wurde versucht, dass Gedächtnissystem zu quantifizieren, um direkte
Aussagen über die Fähigkeiten von Benutzern treffen zu können. Damit lässt
sich für verschiedene Aufgaben berechnen, wie lange der Benutzer für Ihre
Erfüllung braucht und in welchem Maße das Gedächtnissystem belastet wird.
Auf eine intensivere Behandlung dieses Themas wird an dieser Stelle
verzichtet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das
Kurzzeitgedächtnis äußerst begrenzt ist. Müssen Informationen länger
gemerkt werden, muss das Gedächtnissystem dies aktiv unterstützen. Diese
aktive Unterstützung, die mittels des Exekutivsystems realisiert wird, ist
jedoch so aufwendig, dass anderweitige Aufgaben nur sehr begrenzt erfüllt
werden können.

Abbildung 1
Architektur der menschlichen Kognition
(vgl. [Glas94] S. 10)
Für die Softwareergonomie bedeutet das, möglichst immer
alle relevanten Informationen bereit zustellen, so dass der Benutzer sein
Kurzzeitgedächtnis wenig belasten muss.
2.1.2 Die
psychologischen Gestaltgesetze
Der Bildschirm ist zur Zeit die wichtigste
Informationsquelle bei der MCI. Das bedeutet, dass die meisten
Informationen für den Benutzer visuell wahrgenommen werden. Aus diesem
Grund wird im folgenden Abschnitt vor allem auf die Gestaltgesetze
eingegangen, obwohl sie nur einen kleinen Teil der Wahrnehmungstheorie
darstellen.
Die Gestaltgesetze sind Phänomene der visuellen
Wahrnehmung, die in umfangreichen Untersuchungen herausgearbeitet wurden.
Sie basieren auf der Tatsache, dass der Mensch bei der Aufnahme von
visuellen Informationen das Wahrnehmungsfeld in Figur und Grund zerlegt.
Alles was als Figur identifiziert wird, entspricht einem wahrgenommenen
Objekt, der Grund bleibt unbeachtet. Die Frage, was als eine Figur erkannt
wird sollen die Gestaltgesetze beantworten (vgl. [Glas94] S. 25ff).
Das Gesetz der Nähe als eines der bekanntesten
Gestaltgesetze besagt, dass Elemente mit enger räumlicher Nähe als
zusammengehörend wahrgenommen und damit als ein Objekt bzw. eine Figur
erkannt werden. Ordnet man eine zweidimensionale Matrix von Punkten so an,
dass der Abstand in der horizontalen Richtung größer ist als in der
vertikalen, so entsteht ein Bild von mehreren Spalten. Das Gesetz der
Gleichheit bzw. Ähnlichkeit besagt, dass ähnliche oder gleich aussehende
Elemente schneller zum Zusammenschluss anregen als unterschiedliche
Elemente. Wählt man im vorigen Beispiel gleiche Abstände zwischen den
Elementen und ändert die Farbe in vertikaler Richtung, so entsteht bei der
Wahrnehmung der Eindruck von Zeilen. Das Gesetz der guten Fortsetzung
besagt, dass sich schneidende Konturen so interpretiert werden, dass
beteiligte Linien wenn möglich nicht als geknickt erscheinen. Bei dem
Gesetz der Schließung bzw. Geschlossenheit wird ausgesagt, dass nahezu
geschlossene Konturen als eine Figur wahrgenommen werden, wobei das Innere
die Figur und das Äußere der Grund wird. Dabei werden nicht existierende
Teile einer Figur hinzugefügt. Dies gilt für alle Objektgruppen, die
räumlich getrennt sind und bei denen der Betrachter eine kohärente Figur
zu erkennen versucht (vgl. [ISO9241-12] S. 10). Die folgende Abbildung
illustriert die beschriebenen Gesetze.
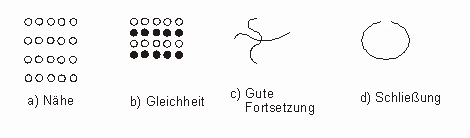
Abbildung 2
Die wichtigsten Gestaltgesetze
Die Gestaltgesetze werden oft in Kombination angewandt.
Dabei folgt der Mensch dem Minimalprinzip, indem für die
analytisch-geometrische Beschreibung des Wahrnehmungsfeldes so wenig wie
möglich Informationen benötigt werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Mensch
außergewöhnliche Fähigkeiten im Bereich der Wahrnehmung besitzt. Er kann
beispielsweise Oberflächen bereits mit kleinsten Hinweisen wahrnehmen. Im
Beispiel in Abbildung 3 glaubt man, ein Dreieck über drei Kreisen zu
sehen. Sogar die Seiten des Dreiecks über dem weißen Papier scheinen
sichtbar.
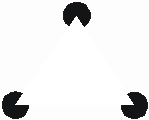
Abbildung 3
Beispiel für subjektive Konturen
Diese Fähigkeit hilft auch bei der Wahrnehmung
dreidimensionaler Elemente. Auf den Gestaltgesetzen lässt sich keine
geschlossene Theorie aufbauen, die den Aufbau des Bildschirminhalts
beschreibt. Einige Hinweise lassen sich dennoch ableiten. So sollten
Objekte auch als solche auf dem Bildschirm dargestellt werden. Dazu werden
umschließende Linien und geschlossene Farbflächen genutzt. Gliedernde
Elemente wie Trennlinien sollten selbst keine Figuren, sondern Grund sein.
Die Bildschirmelemente können durch Abstände in logisch getrennte Bereiche
gegliedert werden. Da Oberflächen und ganze Objekte auch aus Andeutungen
erkannt werden, kann eine dreidimensionale Darstellung auf dem Bildschirm
genutzt werden. Wichtige Objekte im Vordergrund werden vollständig
dargestellt, während im Moment nicht benötigte überdeckt im Hintergrund
angezeigt werden.
Der Ansatz der Gestaltgesetze gibt Aufschluss darüber,
wie Objekte dargestellt werden sollen. Er gibt keine Auskunft darüber,
welche Objekte wann und wo angezeigt werden sollen. Der nächste Abschnitt
beschäftigt sich deshalb mit einem anderen Bereich der Psychologie, der
bei diesen Fragen helfen kann.
2.2
Mentale Modelle
"Die allgemeinste begriffliche Kennzeichnung der
Inhalte des Langzeitgedächtnisses besagt, daß diese mentale Modelle
der Außenwelt in allgemeiner, semantischer (‚Häuser haben Dächer‘) oder
spezieller, episodischer Form (‚Mein Haus hat zwölf Fenster‘) darstellen."
([Glas94] S. 43) Mit ihrer Hilfe versucht der Mensch reale Vorgänge zu
erklären und steuernd darauf einzuwirken. Die kognitive Psychologie
definiert mentale Modelle als Modellierung von Prozessen
(vgl. [Alle97] S. 49). Dabei fasst der Mensch mehrere Schritte eines
Prozesses zusammen und sieht diese als Einheit mit bestimmten In- und
Output. Der Output wird durch die mentalen Modelle "berechnet" und
entspricht bei einem realen Prozess dem vorhergesagten Ergebnis. Die
einzelnen Schritte sind nicht Inhalt des mentalen Modells, sondern
vielmehr unbekannt. Mentale Modelle können nur indirekt beeinflusst
werden.
Ein Benutzer besitzt für die von ihm zu erledigenden
Aufgaben mentale Modelle. Diese sind je nach Vertrautheit mit dem
Aufgabenbereich unterschiedlich stark ausgeprägt. Um ein Anwendungssystem
nutzen zu können, muss der Benutzer sich von diesem ein mentales Modell
bilden. Dieses Modell ist anfangs nur sehr vage und unvollständig. Der
Benutzer versucht nun, dieses unvollständige Modell ständig zu erweitern
und damit das Anwendungssystem zu erfassen und zu verstehen. Für ein
schnelles Einarbeiten und effizientes Arbeiten ist es günstig, wenn
mentales Modell und Anwendungssystem in möglichst vielen Punkten
übereinstimmen. Das heißt, dass der vorhergesagte Output des mentalen
Modells des Benutzers dem tatsächlichen Output des Softwaresystems
entspricht. Ist der Benutzer mit dem Aufgabenbereich nicht vertraut, kann
er sich bei Bildung seines mentalen Modells am Anwendungssystem
orientieren. Soll das Computersystem jedoch bereits existierende
Geschäftsprozesse unterstützen, so besitzt der Benutzer für diese bereits
mentale Modelle. Wird ein Anwendungssystem entwickelt, das diesen
entgegensteht, kann es sehr lange dauern, bis sich der Benutzer angepasst
hat. In diesem Fall ist es günstiger, das Modell des Anwendungssystem dem
mentalen Modell des Benutzers anzupassen. Allerdings ist zu beachten, dass
der Einsatz von Software oftmals auch als Ansatz genutzt wird, bisherige
Prozesse zu analysieren und optimieren.
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass
mentales Modell und Anwendungssystem nie ganz deckungsgleich sind. Aus
diesem Grund müssen Mechanismen bereitgestellt werden, die den Anwender
bestmöglich beim Erlernen des Modells unterstützen. Hilfreich sind dabei
Hilfesysteme und Nutzung von Gleichnissen, auch Metaphern genannt.
2.3
Metaphern
Metaphern stellen einen wichtigen Aspekt im
Softwaredesign dar. Metaphern sind die Überführung von bekanntem
Wissen eines Gebietes auf ein anderes artfremdes Gebiet
(vgl. [NeCa97] S. 441). Das Ziel beim Einsatz einer Metapher besteht
darin, das Anwendungssystem an ein bekanntes Referenzsystem anzulehnen.
Benutzer können damit bereits bekanntes Wissen nutzen und in einem neuen
Kontext anwenden. Da ein Benutzer lediglich Analogien zwischen Quell- und
Zielsystem ziehen muss, wird der Lernprozess erheblich beschleunigt. Die
Quelle von Metaphern stellen bekannte Prozesse, Aufgaben und Situationen
dar. Eine der bekanntesten Metaphern ist die Schreibtischmetapher. Sie
beschreibt den Bildschirmaufbau des Betriebssystems als Schreibtisch.
Dabei werden Objekte wie Dokumente oder Ordner so dargestellt, dass der
Anwender sie sofort als solche erkennt. Auch die Funktionalität kann
mittels einer Metapher ausgedrückt werden. So kann ein Benutzer ein
Dokument mit der Maus direkt über den Papierkorb "ziehen" und "loslassen"
(engl.: Drag and Drop) und damit löschen. Er hat jedoch auch die
Möglichkeit, das Dokument wieder aus dem Papierkorb zurückzuholen und auf
dem Schreibtisch wieder herzustellen. Metaphern werden jedoch nicht nur
eingesetzt, um die Lernprozess zu beschleunigen. Durch die Nutzung von
Gleichnissen ist auch eine einfachere, weil verständlichere Bedienung
erreichbar.
Die Entwicklung zahlreicher Metaphern führte dazu,
Klassifizierungen einzuführen. Hutchins unterscheidet drei Klassen
(vgl. [NeCa97] S. 444f). Metaphern die an den Zielen des Benutzers
ausgerichtet sind, zählt er zu den aktivitätsorientierten Metaphern. Die
zweite Klasse beschreibt die grundlegende Interaktion zwischen Benutzer
und Computer. Die aufgabenorientierten Metaphern beschreiben dagegen, wie
eine Aufgabe strukturiert ist. Marcus unterscheidet lediglich zwischen den
organisierenden und vorgangsbeschreibenden Metaphern. Unter Organisation
versteht er Strukturen, Klassen, Objekte und Attribute. Zu beschreibenden
Vorgänge sind Prozesse, Aktionen und Algorithmen. Es wurden weitere
Klassifizierungen entwickelt, die den Oberflächenentwickler bei der
Auswahl der passenden Metapher unterstützen sollen. Dies ist vor allem vor
dem Hintergrund hilfreich, dass Metaphern selten einzeln, sondern meist in
Kombination genutzt werden (vgl. [Prei99] S. 177).
Der Einsatz von Metaphern birgt jedoch auch Gefahren.
Aus diesem Grund muss bei ihrem Einsatz auf Konsistenz geachtet werden.
Unterscheiden sich die Annahmen und Erwartungen des Benutzers von der in
der Software bereitgestellten Funktionalität entstehen Probleme. Die
Metapher ist in diesem Fall irreführend und beeinträchtigt die Effizienz
der Aufgabenerledigung. Es lassen sich drei verschiedene Konfliktbereiche
identifizieren (vgl. [Prei99] S. 167). Das erste Problem kann darin
liegen, dass das Anwendungssystem Funktionalität bereitstellt, die in der
Analogie nicht möglich ist und somit nicht erfasst wird. Wählt man für ein
Textverarbeitungsprogramm die Metapher der Schreibmaschine, so ist dem
Benutzer die Funktion des automatischen Inhaltsverzeichnisses unbekannt.
Die Metapher unterstützt den Anwender auch nicht, diese Funktionalität zu
erforschen. Solche Aspekte müssen damit durch zusätzliche Mechanismen, wie
beispielsweise Hilfesysteme dem Benutzer zugänglich gemacht werden. Der
zweite Problembereich kann umgekehrt darin liegen, dass der Anwendung im
Vergleich zur Analogie Funktionalität fehlt. Das hat zur Folge, dass der
Benutzer vergeblich versuchen wird, die gewünschte Funktion auszuführen.
Die dritte Klasse von Problemen tritt auf, wenn eine bestimmte Funktion
zwar im Anwendungssystem und in der Analogie existiert, jedoch
unterschiedlich reagiert. Das Ergebnis ist damit für den Benutzer nicht
voraussagbar. Die dadurch bei der Anwendung auftretenden Fehler müssen
anschließend durch den Benutzer im Rahmen des Fehlermanagement beseitigt
werden. Weiterhin ist bei einem internationalem Einsatz der Software zu
beachten, dass die verwendete Metapher in verschiedenen Kulturbereichen
nicht immer die gleiche Aussage besitzen muss.
Auf Grund der zuvor aufgezeigten Probleme müssen die im
Softwaresystem eingesetzten Metaphern bereits frühzeitig evaluiert werden.
Damit kann vermieden werden, dass einerseits Funktionalität unerkannt und
ungenutzt bleibt und das andererseits die Anwendung nicht überschätzt
wird.
© yves köth |