|
Inhalt
• Einleitung
• Ziele •
Psychologie
• Entwurf •
Style Guide
• Prototyp
• Ausblick
• Literatur
• Anhänge
5 Evaluation ergonomischer Oberflächen
Die Evaluierung von interaktiven Systemen dient dazu,
die Benutzbarkeit einer Schnittstelle zu testen und zu verbessern
(vgl. [Prei99] S. 232). Evaluation im Sinne von Qualitätssicherung und
Qualitätsverbesserung stellt einen wichtigen Aspekt bei der Gestaltung
ergonomische Software dar. Mangelhafte Oberflächen können nicht nur zu
Einbußen bei der Effizienz der Aufgabenerledigung, sondern auch zu Fehlern
führen. Diese können abhängig vom Aufgabenbereich des Anwendungssystems
erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Aus diesem Grund muss das Ausmaß
der Evaluation immer dem Softwareprojekt angepasst werden. Studien
belegen, dass schon mit relativ geringen Einsatz bis zu 80 Prozent des
Verbesserungspotential erkannt und umgesetzt werden können
(vgl. [ReMo95] S. 248). Soll ein höherer Prozentsatz erreicht werden,
steigen die Kosten überproportional.
Die ISO 14598 beschreibt den Evaluierungsprozeß für
Software. Da die Norm dafür gedacht ist, ein gesamtes Softwareprojekt zu
beurteilen, kann sie auch bei Benutzungsschnittstellen eingesetzt werden.
Grundsätzlich werden drei verschiedene Ausgangssituationen betrachtet. So
kann der Evaluierungsprozeß entweder im Rahmen der Entwicklung oder
Anschaffung von Software oder unabhängig von beidem durchgeführt werden
(vgl. [ISO14598-1] S. 6). Die entsprechenden Anpassungen des Prozesses
werden in den Teilen drei bis fünf der Norm speziell behandelt. Den
folgenden Ausführungen liegt der im Teil eins spezifizierte allgemeine
Evaluierungsprozeß zu Grunde. Dieser wird in vier Phasen gegliedert
(vgl. Anhang A.10). Im ersten Schritt werden die Anforderungen festgelegt.
Dabei wird der Zweck der Evaluierung definiert. Handelt es sich
beispielsweise um ein Endprodukt, so entscheidet die Evaluierung zwischen
Auslieferung oder Überarbeitung der Software. Zu den Anforderungen gehört
ebenfalls die Spezifikation eines quality model. Ein Qualitätsmodell
(engl. quality model) besteht aus einer Menge von Eigenschaften einer
Software und deren Beziehungen untereinander (vgl. [ISO9126-1] S. 21). Die
ISO 9126-1 beschäftigt sich umfassend mit Qualitätsmodellen. Das dort
vorgestellte Modell quality in use kann als Ausgangspunkt für die
Evaluierung einer Benutzungsschnittstelle gesehen werden (vgl. Anhang
A.12). Nach der Definition der Anforderungen beginnt der zweite Schritt
des Evaluierungsprozesses. Da die vier beispielhaft genannten
Eigenschaften Leistungsfähigkeit, Produktivität, Sicherheit und
Zufriedenheit nicht direkt messbar sind, müssen dafür Indikatoren gefunden
werden. Zeidler und Zellner sehen in der Definition dieser scharfen,
softwareergonomischen Kriterien ein Hauptproblem der Evaluierung
(vgl. [ZeZe92], S.: 189). Wurden geeignete Kriterien gefunden, kann die
Wichtung der einzelnen Merkmale sowie die
Skala für die Messung festgelegt werden. Anhang A.11
zeigt einen Vorschlag der ISO 14598-1 für eine mögliche Einteilung. Der
dritte Prozessschritt umfasst die Entwicklung eines Evaluierungsplanes.
Dazu gehört die Auswahl der Testpersonen, die Festlegung des
Verantwortlichen, die Art der Datenerfassung und -auswertung. Es können
beispielsweise Daten durch Fragebögen, Interviews oder Videoaufnahmen
gesammelt werden. In dieser Phase werden auch die maximalen Kosten
festgelegt. Im abschließenden vierten Schritt findet die eigentliche
Evaluierung statt. Hier werden die einzelnen Kriterien in den Skalen
erfasst, mit den Vorgabewerten verglichen und Auswertungen durchgeführt.
Wurden Probleme bei der Gebrauchstauglichkeit festgestellt, werden diese
anschließend analysiert. In den meisten Fällen existieren mehrere
Lösungsansätze. Diese müssen diskutiert und entsprechend umgesetzt werden.
Dabei sind die Kosten für die Realisierung zu beachten. Vor allem die
Erfassung der Daten wird in vielen Publikationen ausführlich beschrieben.
Eine erfolgreiche Evaluierung ist jedoch ohne sorgfältige Vorbereitung
kaum durchzuführen. Aus diesem Grund sollten alle Schritte des
Evaluierungsprozesses durchlaufen werden.
Grundsätzlich kann die Evaluierung sowohl durch externe
MCI-Experten, das Designerteam oder durch Anwender erfolgen. Experten sind
mit vielen offiziellen Style Guides vertraut. Sie besitzen umfangreiche
Erfahrungen mit Benutzungsschnittstellen und können viele der vorhanden
Probleme an einem Prototypen schnell erkennen. Ein Nachteil dieser
Evaluationsmethode besteht darin, dass Experten die praktischen Probleme
bei der Aufgabenerfüllung nicht kennen (vgl. [ReMo95] S. 252). Dieses
Problem besteht in abgeschwächter Form auch bei der Evaluierung durch das
Designerteam. Allerdings können Designer den aktuellen Entwicklungsstand
kontinuierlich mit den definierten Style Guides und allgemeinen
Gestaltungsprinzipien (vgl. Abschnitt 3.3) abgleichen. Auch die in dieser
Arbeit entwickelten Checklisten (vgl. Anhang B) nutzen Sie, um
Arbeitsschritte sofort zu prüfen. Beide Formen der Begutachtung, bei der
methodisches Vorgehen zur Identifikation von Problemen führt, werden mit
dem Begriff heuristische Evaluation bezeichnet (vgl. [Prei99] S. 242).
Nielsen definiert sie als systematische Prüfung der
Benutzungsschnittstelle auf Gebrauchstauglichkeit (vgl. [Niel93] S. 155f).
Dabei zeigt er anhand von Studien, dass bereits fünf Testpersonen ca. 75
Prozent der Probleme erkannt haben.
Bei der empirischen Evaluierung wird der Test durch die
Benutzer durchgeführt. Dabei unterscheidet man zwischen subjektiven und
objektiven Evaluationsmethoden. Bei beiden Verfahren werden die Probanden
mit dem Prototyp konfrontiert. Erfolgt die anschließende Bewertung durch
den Benutzer persönlich, so nennt man das Ergebnis subjektiv. Wird die
Bewertung anhand von Prüflisten durchgeführt, ergibt sich eine objektive
Evaluierung. Inhalt dieser Prüflisten sind beispielsweise Fehlerraten oder
Lernaufwand.
Auch umfangreiche Maßnahmen der Evaluation geben keine
Garantie für die Entwicklung einer ergonomische Benutzungsschnittstelle.
Wichtig ist, dass schon während der Entwicklung flankierende Maßnahmen,
wie der Einsatz von Werkzeugen oder die Abstellung eines Designerteams für
die Entwicklung der Oberfläche eingeführt werden. Da alle
Evaluationsmethoden zumindest einen Prototypen benötigen, sollte auf
dessen schnelle Entwicklung großen Wert gelegt werden. Vor allem
Schichtenkonzepte, die die Oberfläche von der Anwendung selbst trennen,
ermöglichen die parallele Entwicklung eines solchen. Es sei an dieser
Stelle beispielhaft auf das 1983 entwickelte Seeheim-Modell hingewiesen.
5.1 Prototyping
Die Benutzung von Prototypen ist auch außerhalb der
Informatik weit verbreitet. Aus diesem Grund gibt es verschiedenste
Ansätze für eine Definition. Aus Sicht des Entwicklers von
Benutzungsschnittstellen ist ein Prototyp die Simulation von Aussehen und
Verhalten eines Softwaresystems (vgl. [HoHi97] S. 368). Damit kann bereits
während der Entwicklung einer Anwendung ein konstruktiver Dialog zwischen
Benutzern, Programmierern und Oberflächendesignern in Gang gesetzt werden.
Dieser lenkt die grundsätzlich iterative Entwicklung von Prototypen.
Studien ergaben, dass durch den engen Kontakt zu den Benutzern die
entwickelten Oberflächen leichter zu erlernen und zu benutzen sind
(vgl. [HiHa93] S. 258). Hinzu kommt, dass Anwender die Brauchbarkeit eines
vorhandenes System besser bewerten können als Anforderungen an dieses zu
beschreiben. Ein weiterer positiver Aspekt besteht darin, dass die
Benutzer sich mit dem neuen System bereits vertraut machen können. Dadurch
verkürzt sich die Lernphase nach der Produkteinführung. Durch die
Einbeziehung der Benutzer steigt gleichzeitig die Akzeptanz gegenüber dem
Anwendungssystem. Daraus folgt, dass Prototypen in einer kurzen Zeitspanne
für Demonstrationszwecke einsetzbar sein müssen. Aus diesem Grund können
sie nur einen begrenzten Umfang der Gesamtfunktionalität enthalten. Durch
ständige Evaluierung durch Benutzer und Entwickler und anschließende
Erweiterung und Anpassung des Prototypen wird dieser nach und nach in das
Endprodukt überführt. Um den Funktionsumfang einzugrenzen, können entweder
horizontale oder vertikale Prototypen entwickelt werden. Diese können nur
Teile des Gesamtsystems darstellen. Vor allem in frühen Projektphasen ist
es oft nicht möglich, einen komplett integrierten Prototypen zu erstellen.
5.1.1 Horizontaler Prototyp
Bei dieser Art von Prototypen wird die Tiefe, die die
Funktionalität des Systems widerspiegelt, ausgeblendet. Die Oberfläche ist
im allgemeinen komplett dargestellt. Typische Beispiele sind komplette
Fenster mit Menüeinträgen, Listen, Kombinationsfeldern und anderen
Bildschirmelementen. Eine Dateneingabe ist genauso wenig möglich, wie die
Auswahl einer Systemfunktion. Der Benutzer bekommt damit einen
Gesamteindruck, wie die Anwendung später aussehen wird und welche
Funktionen an welchen Stellen bereit gestellt werden. Damit kann
beispielsweise die globale Metapher des Systems evaluiert werden. Eine
Bewertung der Effizienz ist nicht möglich, da keine Aufgaben durchgespielt
werden können. Es lassen sich lediglich begrenzte Aussagen über die
Effektivität machen. Horizontales Prototyping wird meist für sehr zeitig
entwickelte Prototypen eingesetzt.
5.1.2 Vertikaler Prototyp
Bei dem vertikalen Prototypen wird die Funktionalität
eines kleinen Teilbereiches komplett realisiert. Damit kann der Benutzer
diese Teilaufgabe umfassend bearbeiten. Sowohl Dateneingabe, -verarbeitung
und -ausgabe sind möglich. Der Prototyp stellt insofern bereits eine
fortgeschrittene, dem Endprodukt nahe Realisierung dar. Damit lässt sich
eine konkrete Evaluierung der umgesetzten Funktionen vornehmen.
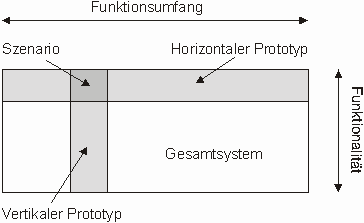
Abbildung 9 Dimensionen des
Prototyping (vgl. [Niel93] S. 94)
5.1.3 Szenario
Werden beide Strategien gemischt eingesetzt, nennt man
den so entstehenden Prototypen Szenario. In diesem ist eine minimale
Funktionalität implementiert. Der Benutzer kann sowohl
Oberflächendarstellung als auch Funktionalität bewerten. Es werden jedoch
keinerlei Freiheiten im Sinne von alternativen Lösungsmöglichkeiten für
den Benutzer angeboten. Das Szenario bestimmt die Umstände und Zeitabläufe
der modellierten Aufgabe. Damit kann bereits in einer frühen Phase die
Nutzung einer bestimmter Funktionen beschrieben und getestet werden, ohne
einen kompletten Prototyp entwickeln zu müssen.
5.1.4 Entwicklung des
Prototypen
Bei der Entwicklung von Prototypen steht das Hauptziel,
schnell ein Ergebnis zu erzielen im Vordergrund. Dabei ist der Grad an
Ausgereiftheit eines Prototypen nicht gleichzeitig der Grad an
aussagekräftigen Ergebnissen (vgl. [Prei99] S. 236). In Studien wurde
gezeigt, dass Benutzbarkeitsprobleme sowohl an einem realen System als
auch an Papierskizzen gleichermaßen erkannt wurden. Ganz im Gegenteil
laden unfertig aussehende Skizzen vielmehr dazu ein, über Varianten
nachzudenken. Fertig scheinende Prototypen sind für eine kreative
Diskussion nicht geeignet. Das legt nahe, am Anfang eines Projektes,
durchaus mit Skizzen o.ä. zu arbeiten. In späteren Phasen folgt die
Entwicklung eines Systems, um eine reale Demonstration zu ermöglichen.
Dabei gibt es einige Punkte zu beachten, die eine Beschleunigung des
Prototyping ermöglichen (vgl. [Prei99] S. 235). Speicher- oder
Zeitoptimierung sind im allgemeinen zu vernachlässigen. Um eine effiziente
Entwicklung zu ermöglichen, sollte ein leistungsfähiges Computersystem
genutzt werden, dass durchaus deutlich besser als das spätere Zielsystem
sein kann. Ein Prototyp kann auch mit fehlerhaftem Kode hilfreich für die
Weiterentwicklung sein, da davon der Test nur wenig beeinflusst wird.
Sonderfälle sollten im allgemeinen nicht im Prototyp realisiert werden,
sondern erst im Endprodukt. Viel Zeit kann auch durch den Einsatz von
Pseudodaten eingespart werden. Dabei wird die Komplexität der realen Daten
gesenkt indem Datensätze geringeren Umfangs benutzt werden.
Prototyping, als Vorgang der Entwicklung eines
Prototyps, sollte jedoch nicht nur schnell sondern auch flexibel und
einfach gestaltet sein. Zum einen ist es wichtig, die Kosten für
Prototyping gering zu halten, zum zweiten soll vermieden werden, dass sich
der Entwickler zu sehr mit dem Prototyp identifiziert und gegen
Veränderungen inflexibel wird.
Um die oben genannten Anforderungen zu unterstützen,
wurde in der Vergangenheit ein Vielzahl von Werkzeugen entwickelt. Damit
soll der Aufwand für die Programmierung gesenkt oder ganz beseitigt
werden. Die Entwicklung von Prototypen unter Einsatz von Werkzeugen wird
unter dem Begriff Rapid Prototyping subsumiert. Eine Erweiterung
stellt das Interactive Prototyping dar. Bei diesem kann der
Benutzer den Prototyp während des Testlaufs manipulieren.
5.2 Werkzeuge
Werkzeuge sind im hier betrachteten Kontext
Anwendungssysteme, die die Entwicklung von Software unterstützen. Sie sind
auf verschiedenen Abstraktionsebenen – von systemnaher Programmierung bis
zu benutzungs- und anwendungsnaher Modellierung – angesiedelt
(vgl. [VoNe98] S. 12). Ein genereller Trend geht zu den objektorientierten
Systemen mit vorgefertigten Dialogelementen hin. Das Baukastenprinzip, das
in den meisten Werkzeugen die zugrunde liegende Metapher ist, ermöglicht
eine einfache Anpassung der Elemente durch Änderung von Parametern. Durch
die Vererbungstechniken können den Dialogelementen neues Verhalten und
Aussehen verliehen werden. In modernen Werkzeugen werden die statischen
Aspekte einer Benutzungsschnittstelle grafisch entwickelt. Dabei wird die
WYSIWYG-Technik angewandt, bei der der Entwickler sofort sehen kann, wie
der Dialog in der Anwendung später aussieht. Der Programmieraufwand wird
dadurch entscheidend gesenkt. Werden Dialogelemente in ihrer
Funktionalität erweitert oder verändert, so können diese in den meisten
Werkzeugen integriert und benutzt werden. Ein Beispiel dafür ist das
Konzept der Java Beans. Die einheitliche Verwendung von Dialogelementen
führt auch anwendungsübergreifend zu einem hohem Grad an Konsistenz.
Zusätzlich unterstützen Style Guides die Konformität. Dieser hohe Grad an
Standardisierung hat jedoch auch Nachteile. So sind viele Komponenten weit
verbreitet und bei Benutzern akzeptiert. Änderungen bzw. Innovationen an
diesen Elementen werden als störend empfunden. Durch die fehlende Toleranz
des Anwenders können sich diese nicht durchsetzen.
Die einfachste Unterstützung bilden User Interface
Toolkits (UI-Toolkits). Ein UI-Toolkit stellt sich dem Programmierer als
Bibliothek von Prozeduren oder Klassen mit standardisierten
Dialogelementen dar (vgl. [VoNe98] S. 13). Durch Aufruf der Prozeduren
oder Instanziierung der Klassen werden Interaktionselemente erzeugt.
Entsprechend den Anforderungen können diese Elemente auf dem Bildschirm
angeordnet, miteinander kombiniert und konfiguriert werden. Die Begrenzung
der Darstellungsmöglichkeiten durch Parameter führt zu einem einheitlichen
Look and Feel. Objektorientierte UI-Toolkits bieten die Möglichkeit, neue
Klassen zu bilden. Durch diese kann neues Aussehen und Verhalten für
bestimmte Elemente erzeugt werden. Application Frameworks sind erweiterte
und spezialisierte objektorientierte UI-Toolkits. Ein Framework ist eine
Sammlung von kooperierenden Objekten, die eine integrierte Lösung eines
bestimmten Anwendungsgebietes anbieten und durch den Entwickler oder
Benutzer angepasst werden können (vgl. [Buzb98]). Damit liefert der
Framework bereits einen Lösungsvorschlag, der durch Unterklassenbildung
der vorgegeben Elemente konkretisiert wird.
Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Werkzeugen
bewegen sich User Interface Builder oberhalb des Programmiersprachenniveau
(vgl. [VoNe98] S. 15). Ein UI-Builder gibt dem Entwickler die Möglichkeit,
die Benutzungsschnittstelle grafisch zu konstruieren. Er stellt die
Elemente eines Toolkits durch Menüs oder Paletten dar. Diese können durch
den Entwickler direkt-manipulativ ausgewählt und positioniert werden. Die
Modifikation der Eigenschaften, wie beispielsweise Farbe, Höhe und Breite
wird auch grafisch unterstützt. Ein UI-Builder setzt auf einem UI-Toolkit
auf. Die durch den Entwickler konstruierten Bildschirmdarstellungen werden
in Kode gewandelt. Dieser kann durch das unterstützte Toolkit
interpretiert werden, womit wieder ein einheitliches Look and Feel erzeugt
wird. Der Vorteil der UI-Builder besteht darin, dass sich der Entwickler
die Prozeduren, Klassen und Parameter des Toolkits nicht merken muss.
Damit können sie auch von Designern ohne Programmierkenntnisse genutzt
werden. UI-Builder bieten in den meisten Fällen einen Testmodus an. In
diesem kann die entwickelte Oberfläche evaluiert werden, ohne zuvor eine
länger dauernde Kodegenerierung und Übersetzung durchzuführen.
Eine noch umfangreichere Unterstützung bieten User
Interface Management Systeme (UIMS). Diese beinhalten sowohl ein
UI-Toolkit als auch einen UI-Builder. Zusätzlich bieten sie eine eigene
Sprache an, um das Dialogverhalten formal zu spezifizieren. Analog zu
einem Datenbank Management System (DBMS) wird während der Laufzeit der
Anwendung daraus die Oberfläche generiert. Einige Systeme steigern die
Leistung während der Ausführung, indem sie die Spezifikation vor der
Ausführung in eine effizienter interpretierbare Form übersetzen. Moderne
UIMS passen ihre eigene Sprache an die Objektstruktur des benutzten
UI-Toolkits an. Neuere Systeme enthalten eine Vielzahl von einzelnen
Werkzeugen. Sie können beispielsweise einen Icon-Designer oder Bildeditor
integrieren. In diesen Fällen spricht man auch von User Interface
Development Environments (UIDE).
Zur Veranschaulichung der verschiedenen Werkzeugebenen
dient die in Abbildung 10 gezeigte Architektur. Jede einzelne Schicht
nutzt die direkt zugänglichen darrunterliegenden Schichten.

Abbildung 10
Schichtenarchitektur von UI-Werkzeugen
(vgl. [VoNe98] S.17)
Wie die Abbildung andeutet, sind anspruchsvolle
Benutzungsschnittstellen nur realisierbar, wenn man für bestimmte
Teilbereiche direkt auf das Basis-Window-System zugreift. Dies zeigt auch
die Begrenztheit aktuell verfügbarer Werkzeuge.
Bei der Entwicklung von Software gibt es viele Gebiete,
die durch Werkzeuge unterstützt werden können. Jedes Werkzeug hat sowohl
Stärken als auch Schwächen, die aus den verschieden Zielen resultieren. So
sind beispielsweise UIMS für industrielle Anwendungen besonders auf
zeitliche Aspekte ausgerichtet. Aus diesem Grund müssen für jedes
Entwicklungsprojekt die Anforderungen an das zu verwendende Werkzeug
definiert werden. Diese Kriterien werden von den Zielen und
Rahmenbedingungen des Softwareprojektes beeinflusst. Im Ergebnis entsteht
eine Katalog, der die Auswahl von geeigneten Werkzeugen ermöglicht.
Im folgenden werden vier Werkzeuge getestet und ihre
Brauchbarkeit für Prototyping bewertet. Die Auswahl wurde durch folgende
Bedingungen eingegrenzt. Da der GME 2001 auf der Basis von Java entwickelt
wird, sollte das Werkzeug ebenfalls diese Sprache unterstützen. Der
Prototyp soll nicht nur horizontal sondern auch vertikal ausgerichtet
sein. Das heißt, dass teilweise Funktionalität implementiert werden muss.
Damit entfallen alle Werkzeuge, die lediglich eine statische Oberfläche
darstellen können. Bei der abschließenden Bewertung standen vor allem
Aspekte des Prototyping und damit der Geschwindigkeit im Vordergrund. Die
Ergebnisse des Vergleichs wurden im Anhang A.1 in einer Tabelle
zusammengefasst. An dieser Stelle befindet sich auch die Spezifikation des
benutzten Testsystems. Dieses ist laut Herstellerangaben der zu prüfenden
Werkzeuge als ausreichend beschrieben.
5.2.1 VisualAge for Java,
Entry Edition 3.0
IBM bietet mit seinem VisualAge for Java eine
integrierte Entwicklungsumgebung für die Programmiersprache Java an. Das
Produkt wird in drei Versionen ausgeliefert. Die hier betrachtete Entry
Edition wird kostenlos vertrieben. Sie beinhaltet alles um einfache
Applikationen bzw. Applets zu programmieren. Allerdings darf bei ihr ein
Projekt maximal aus 750 Klassen bestehen. Die Professional und Enterprise
Edition sind kostenpflichtig und erweitern den Funktionsumfang. Alle
Versionen stehen für die Plattformen MS Windows, Solaris und Unix zur
Verfügung. Das JDK ist fest im Programm integriert. D.h. dass neuere
Versionen erst genutzt werden können, wenn IBM dafür ein Update released.
Die Version 3.0 wird mit dem Java Development Kit 1.2 sowie mit der Java
Foundation Class Version 1.0.3 ausgeliefert.
Die Installation gestaltet sich sehr einfach und
benötigt ca. 200 MB Festplattenkapazität. Nach dem Programmstart, der
knapp eine Minute dauert, erscheint als erstes ein Wizard, der durch die
Erstellung eines neuen Projektes führt. Die empfohlenen 64 MB
Arbeitsspeicher erscheinen zu wenig, da das Programm bereits ca. 50 MB
Speicher belegt. Hinzu kommt, dass für jedes neue Bearbeitungsfenster
weiter fünf MB belegt werden. Nachdem das neue Projekt erstellt
wurde, befindet man sich im Workbench, dem Arbeitsplatz. Dieser ist
Ausgangspunkt für alle Aktivitäten. Er listet alle Projekte, Packages,
Klassen und Interfaces auf. Von hier aus können Arbeitsstände importiert
und exportiert sowie die Versionierung durchgeführt werden. Damit
ermöglicht er die Navigation durch das gesamte Projekt. Der Import bzw.
Export wird benötigt, da IBM in VisualAge for Java ein Repository für die
Speicherung aller Daten benutzt. D.h., dass sowohl alle Quellkodes als
auch die übersetzten Bytekode in einer eigenen Datenbank gesichert werden.
Um die Daten im Repository anzusehen, hat IBM den Repository Explorer
integriert. Mit ihm kann durch die gesamte Datenbank navigiert werden.
Projekte, Klassen, Interfaces können von hier aus in den Workbench
transferiert werden. Erst dann ist eine Bearbeitung bzw. Nutzung dieser
möglich. Das Repository unterstützt ebenfalls eine Versionsverwaltung. Es
ist möglich, einem Projekt, einzelnen Klassen oder Interfaces Versionen
zuzuteilen und zu verwalten. Dies stellt jedoch nur einen einfachen
Mechanismus und kein durchgängiges Konfigurationsmanagement dar.
Nach Anlegen oder Öffnen eines Projektes kann man neue
Klassen mit Hilfe eines Wizard erstellen. Diese werden in einem
Bearbeitungsfenster modifiziert, in dem die eigentliche Programmierung
stattfindet. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Visual Composition
Editor. In diesem werden alle visuellen Komponenten angezeigt. Auf der
linken Seite befindet sich eine Palette aller im Moment verfügbaren Beans.
Standardmäßig sind alle AWT und Swing Komponenten eingestellt. Weitere
Standardelemente sowie eigene Entwicklungen können hinzugefügt werden. Die
einzelnen Komponenten werden mittels Drag and Drop in dem Arbeitsbereich
platziert. Mit Hilfe eines Eigenschaftseditor können ihre Eigenschaften
(engl.: property), wie Größe, Namen, Ausrichtung usw. geändert werden. IBM
hat in dem Visual Component Editor das Konzept der Connections
umgesetzt. Damit kann jedem Ereignis (engl. event), welches von einem
Bildschirmelement ausgelöst wird, eine entsprechende Aktion zugewiesen
werden kann. Dazu klickt man mit der Maus auf das entsprechende Ereignis
der Quellkomponente und anschließend auf eine Methode des Zielobjektes.
Rein theoretisch ist es damit möglich, ganze Anwendungen zu programmieren,
ohne eine einzige Zeile Kode zu schreiben. Über das Symbol Run kann
die programmierte Anwendung gestartet werden. Positiv überrascht die
schnelle Ausführungsgeschwindigkeit. Das liegt vor allem in der Maßnahme
begründet, dass Klassen beim Speichern im Repository gleichzeitig
übersetzt werden und damit auch als Bytekode vorliegen.
VisualAge for Java bietet einen integrierten Debugger.
Threads können gestoppt und wieder fortgesetzt werden, Variablenwerte
angesehen und modifiziert werden. Breakpoints werden ebenfalls
unterstützt. Zusätzlich ist die Nutzung relationaler Datenbanken möglich.
Die Internationalisierung wird mit dem von IBM implementierten Java
Internationalization Framework unterstützt. Das Programm ermöglicht
die Anbindung von externen Konfigurationsmanagementsystemen. Der größte
Nachteil von VisualAge for Java liegt bei dem fest integriertem JDK. Da
der GME 2001 mit dem JDK 1.3 implementiert werden soll, eignet sich das
Produkt für die Entwicklung des Prototypen nicht.
5.2.2 Forte for Java,
Community Edition 1.0
Sun microsystems selbst bietet mit Forte for Java
eine Integrierte Entwicklungsumgebung an. Wie IBM gibt es auch dieses
Produkt in drei Versionen. Die Community Edition ist für nicht
kommerzielle Nutzung ohne Einschränkung frei benutzbar. Ein
Teamunterstützung ist in dieser Version nicht enthalten. Die Internet
Edition sowie die Enterprise Edition sind kostenpflichtig. Auch Sun
microsystems unterstützt die Plattformen Solaris, MS Windows und Unix.
Die Installation gestaltet sich ähnlich einfach bei
VisualAge for Java. Der einzige zusätzliche Schritt ist die Abfrage des
Installationspfades des JDK. Da Forte for Java nicht explizit an eine
bestimmte Version des JDK gebunden ist, wird es auch ohne ein solches
ausgeliefert. Dadurch lässt sich ein Update auf eine neue Version des JDK
durchführen, ohne eine neue Version von Forte for Java zu
benötigen. Mit nur 30 MB Festplattenbedarf benötigt es am wenigsten Platz
von den hier getesteten Tools. Nach dem Start des Programms, erscheinen
Haupt-, Explorer- und Eigenschaftsfenster. Bereits zu diesem Zeitpunkt
werden knapp 60 MB Arbeitsspeicher belegt.
Anschließend kann man mit einem neuen Projekt beginnen
oder den Einstieg mit dem Hilfesystem suchen. Der Getting Started Guide
beschreibt kurz die Erstellung einer kleinen Applikation.
Startet man ein neues Projekt können anschließend neue
Klassen wie beispielsweise Fenster, Java Beans oder JSP über den
Template Chooser angelegt werden. Dieser stellt eine einfachere Form
eines Wizard dar. Er ermöglicht lediglich die Auswahl aus vorgefertigten
Mustern. Navigiert wird in Forte for Java mit Hilfe über des
Explorerfensters. In diesem erscheinen alle visuellen sowie nicht
visuellen Komponenten. Im Hauptfenster kann man zwischen den fünf
Workspaces Editing, GUI-Editing, Browsing, Running und Debugging wechseln.
Alle Fenster sind grundsätzlich einem Workspace zugewiesen. Der Editing
Workspace dient ausschließlich zum modifizieren der Java Quelldateien.
Forte for Java verzichtet auf die Benutzung eines speziellen Repository
und speichert alle Daten in normalen Java-Quelldateien. Den Designmodus
stellt der Workspace GUI-Editing bereit. Hier wird der aktuell ausgewählte
Container, z.B. ein Fenster, grafisch dargestellt. In diesen können
Komponenten über die Komponentenpalette eingefügt werden. Die
Komponentenpalette kann durch den Benutzer selbst erweitert werden. Über
den Eigenschaftseditor werden die Attribute wie Farbe, Position oder Name
gesetzt. Ebenso können hier den Ereignissen Methoden zugeordnet werden.
Übersetzt und startet man das Projekt, wird automatisch in den Workspace
Running gewechselt. Hier findet sich das typische Outputfenster sowie ein
Execution View Fenster. Dieses listet alle aktiven Threads der
Java-Applikation auf. Im Workspace Debugging kann man sein Projekt nach
Fehlern durchsuchen. Er ermöglicht das Setzen von Breakpoints sowie die
Anzeige der überwachten Variablen und Ausdrücke.
Eine gute Unterstützung bei der Eingabe bietet die
dynamic code completion. Nach dem Eintippen eines Klassennamens öffnet
sich eine Liste, die alle dazugehörigen Methoden und Eigenschaften
anzeigt. Zum einen verkürzt sich die Zeit beim Schreiben, zum anderen wird
die Anzahl der Tippfehler gesenkt. Durch den modularen Aufbau des
Produktes kann es ständig ergänzt und erweitert werden. Dabei müssen diese
Module nicht von Sun microsystems sein.
Beim Ausführen eines Projektes steigt der
Ressourcenverbrauch stark an. So werden selbst bei kleinen Anwendungen 130
MB Speicher genutzt. Daraus resultieren relativ lange Wartezeiten während
der Entwicklung. Auch der Wechsel von Workspaces kann sehr lange dauern.
Damit ist Forte for Java für die Entwicklung von Prototypen
ungeeignet.
5.2.3 VisualCafé 4.0
Standard Edition
Die Firma WebGain bietet ebenfalls eine IDE für Java
an. Auch dieses Produkt gibt es in drei Varianten, die hier getestete
Standard Edition, eine Expert Edition sowie eine Enterprise Edition. Die
Standard Edition ist für den privaten Gebrauch frei. WebGain unterstützt
lediglich die Plattform MS Windows. Die entwickelten Java Anwendungen
können auch auf anderen Plattformen genutzt werden.
Die normale Installation benötigt ca. 500 MB
Festplattenspeicher und ist mit über 13.000 Dateien sehr umfangreich. Die
Konzentration auf nur eine Plattform hat positive Auswirkungen auf den
Ressourcenverbrauch des Produktes. So startet das Programm innerhalb von
acht Sekunden und belegt lediglich 20 MB Hauptspeicher. Beim Anlegen eines
neuen Projektes kann man sich zwischen verschiedenen Vorlagen entscheiden.
Diese können durch eigene Projekte erweitert werden.
Anschließend befindet man sich im Workspace Edit.
Dieser besteht aus dem Hauptfenster, in dem sich die Komponentenpalette
befindet, dem Projektexplorer, dem Formdesigner sowie dem
Property-List Fensters. Im Projektexplorer werden alle Objekte,
Klassen und Dateien des aktuellen Projektes angezeigt. Er dient zum
navigieren. Der Formdesigner stellt alle visuellen und nicht visuellen
Komponenten des aktuellen Container dar. Die Darstellung der zweiten
Gruppe ist für die Nutzung des Connection Wizard sinnvoll. Das
Property-List Fenster zeigt alle Eigenschaften eines Objektes an. Hier
können beispielsweise Größe, Farbe oder Positionen eingestellt werden. Der
Connection Wizard verbindet, ähnlich wie bei VisualAge for Java,
Ereignisse mit bestimmten Aktionen. Die Zuordnung wird mit der Maus
durchgeführt. VisualCafé bietet für häufig benötigte Aktionen vorbereitete
Methoden an. Benötigte Parameter können entweder automatisch durch
Eigenschaften anderer Objekte oder manuell übergeben werden. Bei Anwendung
des Connection Wizard können sehr schnell Anwendungen mit umfangreicher
Funktionalität entwickelt werden. Dabei muss kein Java Quellkode
eingegeben werden.
Der zweite Standard Workspace heißt Debug, mit
dem ein Testen des Projektes ermöglicht wird. Es werden Fenster zur
Variablenüberwachung eingeblendet. VisualCafé gestattet es dem
Benutzer eigene Workspace zu erstellen, umzubennen sowie zu löschen. Hinzu
kommen umfangreiche Möglichkeiten die Entwicklungsumgebung anzupassen. Die
Speichernutzung steigt während der Projektausführung auf ca. 50 MB. Damit
benötigt das Produkt von den getesteten Werkzeugen den wenigsten Speicher.
Dieser Vorteil wird hauptsächlich durch die
Plattformabhängigkeit erkauft. Diese ist aber vor allem beim
Oberflächendesign von Nachteil. Es ist unbedingt zu empfehlen, ein Projekt
auf allen Plattformen zu testen, auf denen es später angewendet werden
soll. Ein weiterer Nachteil ist die Abhängigkeit vom mitgelieferten JDK.
Damit ist auch dieses Tool nicht für die Entwicklung des Prototypen GME
2001 geeignet.
5.2.4 JBuilder 4.0
Foundation
Borland/Inprise bietet mit dem JBuilder ebenfalls eine
Java Entwicklungsumgebung an. Auch dieses Produkt gibt es in drei
verschiedenen Varianten. Die Foundation Edition ist kostenlos zu erhalten.
Die Professional sowie die Enterprise Edition erweitern den Umfang der
Foundation um Funktionen wie Datenbankzugriff, Teammanagement oder
Versionsverwaltung.
Das Programm richtet bei der problemlos verlaufenden
Installation das JDK Version 1.3 ein. Dieses kann jedoch gegen eine
beliebige Version ausgetauscht werden. Nach dem Programmstart, ist das
Hauptfenster sichtbar. Die Speicherbelastung, ist mit 30 MB relativ
gering. Der JBuilder besteht im Gegensatz zu den anderen Werkzeugen nur
aus einem Fenster, in dem alle Elemente wie Projektbrowser,
Strukturbrowser, GUI-Builder und Editor eingebettet sind.
Der Projektbrowser ermöglicht die Navigation durch das
gesamte Projekt. Er zeigt alle verfügbaren Klassen an. Der Strukturbrowser
zeigt die innere Organisation der aktuell ausgewählten Klasse an. Dies ist
vor allem für Fenster von Vorteil. Im Arbeitsbereich kann zwischen
verschiedenen Sichten gewechselt werden. Diese sind analog zu den
Workspaces der anderen Werkzeugen. Der Editor ist wie auch in forte for
Java mit einer dynamic code completion ausgestattet. Bei visuellen
Klassen kann die Darstellung im GUI-Builder erfolgen. Zusätzlich wird ein
Eigenschaftseditor und die Komponentenleiste angezeigt. Mittels Drag and
Drop können die Bildschirmelemente in dem Fenster platziert werden. Die
Manipulation ihrer Attribute erfolgt mit Hilfe des Eigenschaftseditor.
Dieser zeigt auch alle Ereignisse des momentan aktiven Elementes an.
Diesen kann direkt Java Quellkode zugewiesen werden, der jedoch
programmiert werden muss. Weitere Sichten im Arbeitsbereich sind die
Dokumentation und die Versionsverwaltung. Die Versionsverwaltung ist
ähnlich einfach wie bei VisualAge for Java gehalten. Die Dokumentation
wird in HTML-Form verwaltet.
Der JBuilder bietet eine Vielzahl von
Individualisierungsmöglichkeiten. So kann man beispielsweise Quellkode als
Vorlage (engl.: template) anlegen. Diese kann mit einem Ereignis einer
Klasse verknüpft werden. Damit kann ein ähnliches Konzept wie das des
Connection Wizards in VisualCafé aufgebaut werden.
Auch während der Ausführung bleibt der Speicherbedarf
mit ca. 55 MB relativ gering. Lediglich im Debug-Modus wird die
Entwicklungsumgebung deutlich langsamer. Vorteile sind die Unabhängigkeit
sowohl von der Version des JDK als auch von der Plattform des
Betriebssystems. Die grafische Gestaltung von Fenstern ist einfach und
schnell durchzuführen. Eine Erweiterung mit Funktionalität ist ohne
Schwierigkeiten durchführbar.
Aus den genannten Gründen wird der Prototyp GME 2001
mit Hilfe des Werkzeuges JBuilder 4.0 entwickelt.
5.3 Entwicklung des Prototypen GME 2001
Im Rahmen der Diplomarbeit wurde ein Prototyp für den
Generischen Modelleditor 2001 (GME 2001) entwickelt. An diesem Projekt
wird seit Februar 2000 an der TU Dresden am Lehrstuhl für
Systementwicklung intensiv gearbeitet (vgl. [Grei00a]). Das Ziel ist die
Entwicklung eines innovativen Modellierungswerkzeuges.
Der Prototyp ist in dem Bereich Division
Client des Projektes angesiedelt. Dieser Teil beschäftigt sich mit der
Entwicklung der Clients. Diese sind auf die Servermodule aufgesetzte
Anwendungen, die die Kommunikation zwischen Modellierern und Datenbank
(Repository) übernehmen. Damit fällt in diesen Bereich auch die
Entwicklung einer Benutzungsschnittstelle. Der hierfür entwickelte
Prototyp soll vor allem die herausgearbeiteten ergonomischen Aspekte
beachten. Der GME 2001 wird mit der Programmiersprache Java implementiert.
Daraus ergibt sich, dass auch der Prototyp für die Oberfläche in Java
umgesetzt wird. Die Benutzung einer einheitlichen Sprache ist zwar nicht
zwingend erforderlich, vereinfacht aber die iterative Entwicklung. Für die
Umsetzung wird das Werkzeug JBuilder 4.0 verwendet. Es ist eine der
schnellsten Entwicklungsumgebungen für Java-Applikationen. Zusätzlich kann
das aktuelle Java Development Kit 1.3 verwendet werden, mit dem bereits
vorhandene Teile des GME 2001 implementiert wurden.
5.3.1 Beschreibung des E3-Ansatz
Der Generische Modelleditor 2001 basiert auf dem E3-Ansatz.
Dieser Ansatz verfolgt das Ziel, Modellbeschreibungen zu standardisieren.
Unter einem Modell wird eine formale Sprache zur Beschreibung von Schemata
verstanden. Schemata sind formale Abbildungen von realen Sachverhalten
bzw. Problembereichen (vgl. [GrEs01] S. 5). Ein Meta-Modell ist eine
formale Sprache zur Beschreibung von Modellen (vgl. [FeSi98] S. 119). Eine
Gruppe von Bestandteilen oder der Ausschnitt eines Schemas wird als View
bezeichnet. Die Darstellung einer View wird als Präsentation definiert.
Das E3-Modell ist ein Meta-Modell, das die
einheitliche Definition von Modellen ermöglicht. Es gliedert sich in zwei
Teile, der Typebene und der Instanzenebene. Die Typebene nimmt alle
Modelle der Beschreibungsmodelle auf (vgl. [GrEs01] S. 8). Die Modelle
werden im GME 2001 im Typeneditor erstellt und bearbeitet. Die
Instanzenebene nimmt alle Ausprägungen dieser Modelle, also alle Schemata
auf. Diese werden im GME 2001 im Schemaeditor bearbeitet. Die Typ und
Instanzenebene werden vertikal in die drei Teile Kontextebene, Viewebene
und Präsentationsebene unterteilt. Das Modell wird zur Verfeinerung auch
horizontal in drei Ebenen gegliedert. Daraus ergeben sich insgesamt 18
Berührungspunkte, die als E3-Elemente bezeichnet werden
(vgl. Anhang A.2). Auf die genaue Beschreibung der einzelnen Elemente und
ihre Beziehungen untereinander wird hier nicht eingegangen.
5.3.2 Ziele des Prototypen
Bei der Erstellung des Prototypen ergeben sich zwei
Hauptgebiete. Die erste Aufgabe umfasst die Beschreibung der Oberfläche
des gesamten GME 2001. Hierzu wurde der Prototyp horizontal ausgerichtet.
Dabei standen verschiedene Anforderungen im Vordergrund:
Unterstützung eines Konfigurationsmanagement
Teamfähigkeit
verteilte Architektur
Die zweite Aufgabe betrifft die Entwicklung des
Typeneditors. Bei diesem wurde auch Funktionalität implementiert. Dazu
wurde der Prototyp zusätzlich vertikal ausgerichtet. Besondere Beachtung
muss dem Umstand beigemessen werden, dass es in der neuen Spezifikation
des E3-Modells möglich ist, Views auf Views zu bilden (vgl. Anhang A.3).
Der Schemaeditor wurde im Prototyp nicht implementiert.
5.3.3 Spezifikation des
Prototypen
Die Entwicklung des Prototypen begann mit der Erfassung
der nötigen Informationen. Für den Arbeitsablauf war die bereits
vorhandene Version 0.91 des GME hilfreich. Diese beinhaltet sowohl den
Typeneditor, als auch den Schemaeditor. Die Anforderungen, die im
Abschnitt 5.3.2 beschrieben wurden, erfordern jedoch eine umfassende
Projektverwaltung. Der Benutzer wurde in der Anforderungsspezifikation des
GME 2001 (vgl. [Grei00b]) als Modellierer definiert. Dieser hat ein
grundsätzliches Verständnis über den Ablauf eines Modellierungsprojektes.
Aus diesem Grund wurde auch diese Metapher im Workspace eingesetzt. Der
Benutzer erhält den Eindruck, ein Projekt durchzuführen, in dessen Rahmen
Modelle und Schemas erstellt bzw. bearbeitet werden. Diese Projektsicht
wird in vielen Werkzeugen eingesetzt, was zu einer hohen
Erwartungskonformität führt. Um eine entsprechende funktionale Oberfläche
zu erhalten, wurden im zweiten Schritt Use case Diagramme sowie
Klassendiagramme entwickelt (vgl. Anhang C.1). Diese wurden dann mit Hilfe
des Tools JBuilder 4.0 in einen Prototypen umgesetzt.
Dabei wurde vor allem dem Workspace und dem Typeneditor
Beachtung geschenkt. Beide Teile werden deshalb noch näher spezifiziert.
Das Hilfesystem wurde durch einen HTML-fähigen Browser dargestellt
(vgl. Abschnitt 3.4.6). Diese enthält keine Möglichkeiten zum Information
Retrieval. Eine entsprechende Funktionalität muss noch ergänzt werden. Die
Individualisierungsmöglichkeiten wurden angedeutet, jedoch nicht
implementiert. Auch sie müssen noch ergänzt werden. Die im Prototyp
verwendeten Icons sind zum größten Teil aus dem GME 0.91. Sie müssen
entsprechend den Empfehlungen und Richtlinien dieser Arbeit
(vgl. Abschnitt 3.4.4) noch überarbeitet werden.
5.3.3.1 Workspace
Der Workspace übernimmt die Verwaltung des gesamten
Modellierungsprojektes. Er ist in die Bereiche Projektbrowser,
Arbeitsbereich und Aufgabenmanagment unterteilt (vgl. Anhang A.4). Der
Projektbrowser enthält alle Objekte des aktuell ausgewählten Projektes.
Dazu gehören die Projektdaten, alle Schemata und Modelle, die
Dokumentation, die beteiligten Mitarbeiter, Scripte und die Change
Requests. Letzteres sind Änderungsanträge, die erst bei einem
fortgeschrittenen Projektstatus erforderlich sind. Zusätzlich wurde die
Kategorie sonstiges eingeführt, die als Ordner für alle zum Projekt
gehörenden Dokumente dient. Das können beispielsweise vom Auftraggeber
gelieferte Spezifikationen vorhandener Style Guides o.a. sein. Jedes
Projekt wird durch die Klasse Project abgebildet. Die Spezifikation
befindet sich im Anhang C.3.1. Der Arbeitsbereich passt seinen Inhalt
entsprechend der Auswahl im Projektbrowser an. Hier werden die
Detailinformationen zum gewählten Objekt angezeigt. Diese Informationen
können an dieser Stelle direkt geändert werden. Voraussetzung ist eine
entsprechende Berechtigung beim Benutzer. Das Aufgabenmanagement wird im
Workspace durch eine Tabelle dargestellt. Diese zeigt für den angemeldeten
Benutzer alle verfügbaren Einträge an. Eine Aufgabe wird im Prototyp durch
die Klasse Task (vgl. Anhang C.3.2) abgebildet. Die Tabelle kann durch den
Benutzer nach Verlangen entsprechend sortiert werden. Überfällige Aufgaben
werden farblich hervorgehoben. Die Einführung des Aufgabenkonzeptes bringt
zwei Vorteile. Zum einen kann der Benutzer seinen Arbeitsablauf selbst
strukturieren. Zum anderen kann durch die Erstellung von Aufgaben, sowohl
durch den GME 2001 selbst als auch durch andere Mitarbeiter, der Prozess
gesteuert werden. Wechselt beispielsweise der Modellierer den Status eines
Schemas von edit auf stable so kann der GME 2001 automatisch die Aufgabe
"Schema testen" generieren. Sind mehrere Tester im Projekt vorhanden, so
muss der Modellierer nur noch den entsprechend verantwortlichen
Mitarbeiter auswählen. Die so generierte Aufgabe erscheint anschließend
nicht im eigenen sondern im Workspace des Testers. Zusätzlich kann im
Aufgabenmanager zu jedem Mitarbeiter eine Liste aller Aufgaben eingesehen
werden. Der Aufgabenmanager wird in einem eigenen Fenster dargestellt.
Damit können Engpässe durch den Projektleiter erkannt und beseitigt
werden. Bei dieser Funktion sind jedoch Datenschutzbestimmungen zu
beachten.
Für die Erstellung eines neuen Projektes, Modells,
Schemas oder einer neuen Aufgabe wurden Wizards (vgl. Anhang A.5)
implementiert. Diese unterstützen den Benutzer bei der Erfassung
relevanter Daten. In den Wizards nicht erfasste Daten können zu einem
späteren Zeitpunkt im Arbeitsbereich modifiziert und ergänzt werden.
Der aktuelle Arbeitsstand wird immer lokal gespeichert.
Für die Überführung der lokalen Daten in das Repository bzw. zurück stellt
der Workspace die zwei Funktionen Checkin und Checkout zur Verfügung.
Beide Operationen werden ebenfalls mittels eines Wizards unterstützt. Vor
allem für den Checkin, also die Überführung der lokalen Daten in das
Repository, wird dieser benötigt. Ist die einzubringende Konfiguration
bereits vorhanden, so muss der Benutzer über die weitere Behandlung
entscheiden. Wird weder die Funktion branch noch die Funktion merge
durchgeführt so muss lediglich eine neue Versionsnummer gebildet werden.
Beim branch wird eine Verzweigung der Version vorgenommen. Es entstehen
damit zwei Elemente mit einem gemeinsamen Vorgänger. Beim merge werden die
lokalen Elemente mit den im Repository vorhandenen zu einem einzigen
vereint. Es entsteht ein neues Element mit zwei Vorgängern.
Die jeweilig verfügbaren Versionen werden sowohl
textuell, d.h. in Listen und Bäumen angezeigt, als auch als durch einen
Konfigurationsgraph visualisiert. Dies ist im Prototyp nur durch
entsprechende Bildschirmelemente angedeutet, jedoch nicht implementiert.
Der Workspace ermöglicht ebenfalls den Zugriff auf das
Benutzermanagement, das Konfigurationsmanagement und die statistische
Auswertung. Die Funktionen wurden nur angedeutet, jedoch nicht
implementiert. Die statistische Auswertung soll vor allem zur
Nachkalkulation der Projektkosten sowie als Erfahrungspool für zukünftige
Projekte dienen.
Der Workspace gestattet es dem Benutzer ein neues
Modell anzulegen. Dabei wird eine neue Instanz der Klasse Model erzeugt.
Diese sammelt alle Informationen über das Modell (vgl. Anhang C.3.3). Der
eigentliche Vorgang der Modellierung findet im Typeneditor statt. Dieser
wird vom Workspace aus unter Angabe des relevanten Modells gestartet.
5.3.3.2 Typeneditor
Der Typeneditor dient zur Entwicklung von Modellen. Um
die Gliederung des E3-Modells widerzuspiegeln, wurden die Kontext-, View-
und Präsentationsebene nebeneinander dargestellt. Jede Ebene wird durch
einen Baum visualisiert. Damit lassen sich die Verfeinerungen innerhalb
der Ebene ebenfalls abbilden (vgl. Abbildung 11). Jedes Element in einem
dieser Bäume entspricht einem E3-Element.
In der Kontextebene lassen sich ObjektTypen und
ObjektPropertyTypen anlegen und löschen. Die neu erstellten Elemente
dieser Ebene werden grundsätzlich grau dargestellt. In der Viewebene
lassen sich nur ViewTypen anlegen. Diese können hierarchisch gegliedert
werden. Damit können View- auf ViewTypen abgebildet werden.
ViewObjektTypen und ViewPropertyTypen werden nur indirekt angelegt bzw.
entfernt. Dazu wird der entsprechende ObjektTyp bzw. ObjektPropertyTyp
selektiert und dem ViewTypen zugeordnet. Ist eine Zuordnung erfolgt, so
wird das Element in der Kontextebene nicht mehr grau, sondern schwarz
dargestellt. Daraus ergibt sich, dass alle grau dargestellten Elemente der
Kontextebene in dem selektierten ViewTypen verfügbar sind. Wird ein
untergeordneter ViewTyp selektiert, so werden alle dem übergeordneten
ViewTyp zugeordneten ObjektTypen bzw. ObjektPropertyTypen grau
dargestellt. Die restlichen Elemente sind in dem untergeordneten ViewTypen
nicht verfügbar und werden ausgeblendet. Ein PräsentationsObjektTyp ist
ebenfalls immer genau einem ViewTypen zugeordnet. Aus diesem Grund ändert
sich die Menge der angezeigten PräsentationsTypen in Abhängigkeit der
Selektion in der Viewebene. Die folgende Grafik verdeutlicht diesen
Sachverhalt.
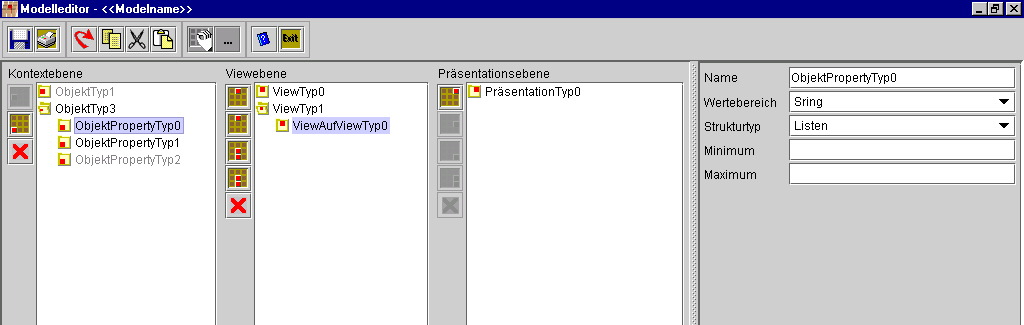
Abbildung 11
Typeneditor
Die Abbildung 11 stellt den Typeneditor während der
Benutzung dar. Aus der farblichen Gestaltung der Kontextebene lässt sich
erkennen, dass ObjektTyp1 und ObjektTyp3 inklusive ObjektPropertyTyp0 bis
ObjektPropertyTyp2 dem ViewTyp1 zugeordnet wurden. Der ObjektTyp0 und
ObjektTyp2 werden hier nicht dargestellt, da diese für den selektierten
ViewAufViewTyp0 nicht verfügbar ist. Diesem Typ wurde der ObjektTyp3 und
zwei ObjektPropertyTypen zugeordnet, die damit in möglichen
untergeordneten ViewTypen sichtbar sind. Dem ViewAufViewTyp2 ist ein
PräsentationsTyp zugeordnet. Rechts von der Präsentationsebene ist der
Eigenschaftseditor eingeblendet. Die in der Symbolleiste angezeigten
Piktogramme weisen derzeit drei verschiedene Stilarten auf. Im Rahmen der
iterativen Entwicklung muss diese ergonomische Schwäche noch beseitigt
werden.
Die E3-Elemente besitzen unterschiedliche
Eigenschaften, die im Eigenschaftseditor bearbeitet werden können. Dieser
kann je nach Wunsch ein- bzw. ausgeblendet werden. Das Hinzufügen,
Entfernen und Bearbeiten von Elementen wird über die jeweils links vom
Baum abgebrachten Buttons realisiert. Die aktuelle Selektion in den
verschiedenen Bäumen steuert ihre Verfügbarkeit. So kann ein
PräsentationsObjektTyp nur angelegt werden, wenn in der Kontextebene ein
ObjektPropertyTyp selektiert ist und dieser in der aktuell ausgewählten
View eingebunden ist. Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, wird der
Button disabled, d.h. der Benutzer kann ihn nicht anklicken. Der Zustand
wird durch eine graue Darstellung des Button signalisiert.
Im unteren Teil des Typeneditor soll eine grafische
Darstellung des E3-Modells angezeigt werden. Denkbar ist eine automatische
Generierung von Struktur- oder Kontextdiagrammen. Die Darstellung wurde
mit einer Grafik angedeutet, eine funktionale Implementierung existiert im
Prototyp nicht.
© yves köth |