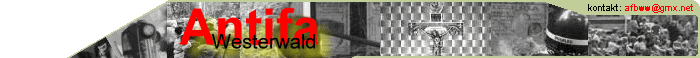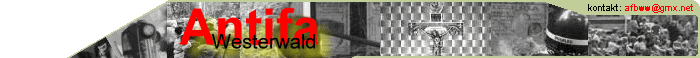Baader-Meinhof-Gruppe (auch Baader-Meinhof-Bande),
terroristische Vereinigung, die ab den späten sechziger Jahren
durch Gewaltakte und Anschläge die gesellschaftliche Ordnung
der Bundesrepublik Deutschland umstoßen wollte. Aus der
Baader-Meinhof-Gruppe ging später die Rote-Armee-Fraktion
(RAF) hervor. Mitglieder und Sympathisanten kamen ursprünglich
im Wesentlichen aus kritischen linksintellektuellen Kreisen
der 68er-Bewegung und der dort geführten Gewaltdebatte
(„Gewalt gegen Sachen”), verselbständigten sich dann aber in
Richtung politischer Untergrund. Die Gruppe wurde nach ihren
Anführern Andreas Baader (1943-1977) und der bekannten
Journalistin Ulrike Meinhof (1934-1976) benannt, die zunächst
durch ihre engagierten Beiträge in der Zeitschrift „Konkret”
aufgefallen war, bevor sie in die politisch motivierte
Kriminalität abtauchte.
Nach anfänglichen Brandanschlägen auf
Kaufhäuser nahm die Gruppe später gezielt staatliche
Einrichtungen und Repräsentanten von Staat und Wirtschaft ins
Visier. In ihrem Bestreben um größtmögliche Effizienz bei der
Durchführung ihrer Aktionen ließen sich die Mitglieder durch
palästinensische Guerillakämpfer in Jordanien ausbilden. 1972
begann eine Serie von Banküberfällen, aus denen sich die
Gruppe auch in späteren Jahren regelmäßig finanzierte. Im
gleichen Jahr wurden Bombenattentate auf Einrichtungen der
US-amerikanischen Armee und der deutschen Polizei
durchgeführt. Im Juni 1972 wurden die Drahtzieher („harter
Kern”) der Gruppe (neben Baader und Meinhof noch Gudrun
Ensslin, Holger Meins und Jan Carl Raspe) verhaftet. Zwei
Jahre später folgten die langwierigen Baader-Meinhof-Prozesse
in Stammheim, die durch zahllose Erschwernisse vonseiten der
Angeklagten und ihrer Verteidiger (vor allem in Form von
Befangenheitsanträgen gegen Richter, Vorwurf der
Isolationshaft usw.) geprägt waren. Die dadurch ausgelöste
rechtspolitische Diskussion führte zu neuen
Verfahrensordnungen und einem geänderten Strafvollzug, der
u. a. die als fragwürdig empfundene Zwangsernährung von im
Hungerstreik befindlichen Häftlingen mit sich brachte. 1975
besetzten Mitglieder der Gruppe die Deutsche Botschaft in
Stockholm, mit dem Ziel, die Freilassung der Gefangenen zu
erpressen. Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt
verweigerte jedoch jegliche Verhandlungen. Die Terroristen
sprengten daraufhin nach der Ermordung zweier
Botschaftsangestellter das Gebäude in die Luft.
Während der immer noch andauernden
Prozesse starb Holger Meins 1976 an den Folgen seines
Hungerstreikes, und Ulrike Meinhof erhängte sich in ihrer
Zelle. Die übrigen Angeklagten wurden im April 1977 zu
lebenslänglichen Freiheitsstrafen verurteilt, woraufhin
Mitglieder der Gruppe versuchten, die Freilassung der
Inhaftierten zu erpressen: Im Herbst 1977 entführten
Mitglieder der als RAF auftretenden Gruppe den prominenten,
u. a. auch verbandspolitisch engagierten Unternehmer Hanns
Martin Schleyer. Außerdem brachten die Terroristen ein
Flugzeug der Lufthansa in ihre Gewalt. Auch jetzt blieb die
Bundesregierung hart. Am 17. Oktober wurde das Flugzeug in
Mogadishu (Somalia) von einer Spezialeinheit zur
Terroristenbekämpfung, der GSG 9, erfolgreich gestürmt. Kurz
darauf wurde Schleyer ermordet im Kofferraum eines Autos
aufgefunden. Am 18. Oktober 1977 fanden Vollzugsbeamte die
Verurteilten Baader, Ensslin und Raspe erhängt in ihren Zellen
vor. Trotz einiger (von den Betroffenen möglicherweise bewusst
als „falsche Fährten” ausgelegten) Unstimmigkeiten kamen die
amtlichen Ermittlungen zu dem Ergebnis, dass die Inhaftierten
Selbstmord begangen hatten.
Microsoft ® Encarta ® Enzyklopädie 2003.
© 1993-2002 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.