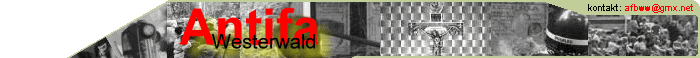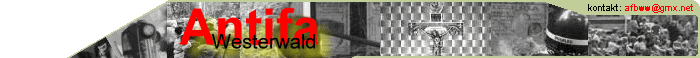|
Rote-Armee-Fraktion (Abkürzung RAF), Eigenbezeichnung
einer 1968 entstandenen linksextremistischen und gegen das
gesellschaftliche System der Bundesrepublik Deutschland
gerichteten terroristischen Gruppierung, die aus der nach ihren
Anführern Andreas Baader und Ulrike Meinhof benannten
Baader-Meinhof-Gruppe hervorging. Die RAF verstand sich als Teil
des internationalen Terrorismus, ihre Mitglieder wurden zum Teil
im Nahen Osten von palästinensischen Widerstandskämpfern
militärisch ausgebildet und unterhielten Beziehungen zu
terroristischen Gruppen im Ausland wie der Action Directe
in Frankreich, der IRA in Irland oder den Roten Brigaden in
Italien. Seit den achtziger Jahren erhielten RAF-Mitglieder
Ausbildung und Unterschlupf auch in der DDR. Ihr Vorbild waren
die Tupamaros im Uruguay der sechziger Jahre. Im Umfeld der RAF
agierten eine Reihe nicht aktiver Sympathisanten.
Die Rote-Armee-Fraktion hatte ihre Wurzeln in der
außerparlamentarischen Opposition (APO) und der
Studentenbewegung der sechziger Jahre. Zu den Aktionen der RAF
gehörten neben Anschlägen auf US-amerikanische Einrichtungen in
Deutschland vor allem Attentate auf Repräsentanten des Staates
und der Wirtschaft. Viele dieser Aktionen stellten
Befreiungsversuche oder Racheakte für inhaftierte bzw. getötete
RAF-Mitglieder dar. Seit Anfang der siebziger Jahre verübte die
RAF planmäßig Gewaltakte gegen Menschen. In den 20 Jahren Terror
wurden dabei mindestens 30 Menschen getötet.
Bereits nach dem Tod des Studenten Benno Ohnesorg bei
einer Anti-Schah-Demonstration in Berlin im Juni 1967 und nach
dem Mordanschlag auf den Studentenführer Rudi Dutschke Ostern
1968 wurde bald bei Protestaktionen kein Unterschied mehr
zwischen der „Gewalt gegen Sachen” (so ging u. a. im April 1970
das Arbeitszimmer des Berliner Kammergerichtspräsidenten Günter
von Drenkmann in Flammen auf) und der „Gewalt gegen Personen”
gemacht.
Ihren Anfang genommen hatte die gewalttätige
Entwicklung der APO im April 1968 in Frankfurt: Andreas Baader
und Gudrun Ensslin hatten mit anderen in einem Kaufhaus Feuer
gelegt, um ein Zeichen gegen den Vietnamkrieg zu setzen. Im
Oktober desselben Jahres wurden sie wegen versuchter
menschengefährdender Brandstiftung zu drei Jahren Haft
verurteilt; im Juni 1970 befreite die Journalistin Ulrike
Meinhof den inhaftierten Andreas Baader. Im Untergrund begannen
beide mit dem Aufbau der so genannten Rote-Armee-Fraktion, und
seit diesem Zeitpunkt führten sie ihren „bewaffneten Kampf”
gegen das „imperialistische System” der Bundesrepublik, gegen
die NATO und den „militärisch-industriellen Komplex”.
Baader, Meinhof, Jan-Carl Raspe und Ensslin wurden
für eine Serie von Bomben- und Brandanschlägen verantwortlich
gemacht und im Juni 1972 verhaftet. Die Ziele der Terroristen
der ersten Generation waren anfangs noch politisch motiviert,
doch der zweiten und dritten Generation ging es in ihrem Kampf
in erster Linie um die Freilassung der inhaftierten
RAF-Mitglieder.
Die Gewalt eskalierte: Zu den ersten Opfern zählten
der Präsident des Berliner Kammergerichts, Günter von Drenkmann,
der am 10. November 1974 erschossen worden war, und der
Militärattaché Andreas von Mirbach sowie der Botschaftsrat Heinz
Hillegaart, die am 24. April 1975 beim Überfall auf die deutsche
Botschaft in Stockholm starben.
Während des so genannten Deutschen Herbstes 1977 war
es zur größten Eskalation der Gewalt gekommen. Am 29. März 1977
hatte in Stammheim der Hungerstreik der dort einsitzenden
RAF-Mitglieder (Ulrike Meinhof hatte sich im Mai 1976 das Leben
genommen) begonnen, um gegen ihre Haftbedingungen zu
protestieren. Ihr Hungerstreik wurde außerhalb der
Gefängnismauern durch Terroranschläge der übrigen RAF-Mitglieder
begleitet: In Karlsruhe ermordeten sie am 7. April 1977
Generalbundesanwalt Siegfried Buback und zwei seiner Begleiter.
Der mutmaßliche Buback-Attentäter Knut Folkerts wurde am
22. September 1977 in den Niederlanden festgenommen; bei der
Festnahme wurde ein Polizist durch Schüsse tödlich verletzt.
Baader, Ensslin und Raspe wurden am 28. April 1977
nach fast zweijähriger Verhandlungsdauer vom Oberlandesgericht
Stuttgart zu lebenslanger Haft verurteilt. Am 2. Juni desselben
Jahres verurteilte das Landgericht Kaiserslautern Manfred
Grashof und Klaus Jünschke ebenfalls zu lebenslangen Haftstrafen
und am 20. Juli 1977 das Oberlandesgericht Düsseldorf vier
weitere RAF-Mitglieder wegen Überfalls auf die deutsche
Botschaft in Stockholm zu lebenslangen Freiheitsstrafen.
Die Terroraktionen setzten sich fort: am 30. Juli
1977 wurde der Vorstandsvorsitzende der Dresdner Bank, Jürgen
Ponto, in seinem Haus in Oberursel bei Bad Homburg erschossen.
Die mutmaßlichen Täter, Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt,
wurden 1985 zu lebenslanger Haft verurteilt.
Der Präsident der Arbeitgeberverbände und des
Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Hanns Martin Schleyer,
wurde am 5. September 1977 in Köln entführt. Sein Fahrer und
drei Polizisten wurden bei diesem Überfall getötet. Der
Bundestag verabschiedete u. a. als Reaktion auf die
Schleyer-Entführung am 29. September desselben Jahres ein Gesetz
über eine zeitlich begrenzte Kontaktsperre für inhaftierte
Terroristen. Auf die Forderungen der RAF, die Inhaftierten
freizulassen, ging der Krisenstab der Bundesregierung unter
Bundeskanzler Helmut Schmidt nicht ein, auch dann nicht, als am
13. Oktober 1977 eine Lufthansa-Maschine mit 91 Menschen an Bord
von vier palästinensischen Terroristen nach Somalia entführt
worden war. Der Flugkapitän Jürgen Schumann wurde vier Tage
später in Aden von den Flugzeugentführern erschossen. Am
18. Oktober stürmte ein Kommando des Bundesgrenzschutzes (GSG 9)
in Mogadishu die Maschine und befreite die Geiseln. In Stammheim
begingen daraufhin Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl
Raspe Selbstmord; Irmgard Möller überlebte schwer verletzt.
Einen Tag später wurde Hanns Martin Schleyer im Elsass ermordet
aufgefunden. Am 12. November 1977 nahm sich die in München
inhaftierte Terroristin Ingrid Schubert in ihrer Zelle das
Leben.
Die so genannte dritte Generation der RAF setzt die
Welle der Gewalt nach 1977 fort. Zu ihren bekanntesten Opfern
zählen: der MTU-Manager Ernst Zimmermann (1985), der Diplomat
Gerold von Braunmühl und der Siemens-Manager Karl Heinz Beckurts
(1986), der Deutsche-Bank-Vorstandssprecher Alfred Herrhausen
(1989) und der Treuhandchef Detlev Karsten Rohwedder (1991). All
diese Attentate blieben unaufgeklärt, die Mitglieder der dritten
Generation der RAF bleiben weitgehend unbekannt. Am 10. April
1992 verkündete die RAF, „Angriffe auf führende Repräsentanten
aus Wirtschaft und Staat” einzustellen. Seit dem Tod von
Wolfgang Grams und der Festnahme von Birgit Hogefeld im Juli
1993 in Bad Kleinen kann die Rote-Armee-Fraktion als zerschlagen
gelten.
Am 20. April 1998 erklärten die letzten noch im
Untergrund lebenden Mitglieder der RAF durch ein Fax an die
Presseagentur Reuter die Rote-Armee-Fraktion für aufgelöst. In
dem von der deutschen Generalbundesanwaltschaft als authentisch
bezeichneten Schreiben heißt es: „Heute beenden wir dieses
Projekt. Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte.”
Als Grund wurden strategische Fehler genannt, u. a. hätte die
RAF versäumt, neben der illegalen bewaffneten Organisation eine
politisch-soziale Bewegung aufzubauen. Auch habe man die Wirkung
der terroristischen Aktionen überschätzt.
In der Auseinandersetzung mit dem Terrorismus
reagierte die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag mit
Gesetzesänderungen und verschiedenen neuen Gesetzen
(„Anti-Terror-Pakete”, Kronzeugenregelung). In diesem
Zusammenhang kam es auch zu verstärktem Einsatz des Bundesamtes
für Verfassungsschutz. Darüber hinaus lösten die Ereignisse seit
den späten sechziger Jahren eine umfassende gesellschaftliche
Diskussion aus, die bis heute noch nicht abgeschlossen ist.
Verfasst von:
Mathias Boxleitner
Microsoft ® Encarta ® Enzyklopädie 2003. © 1993-2002
Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
|