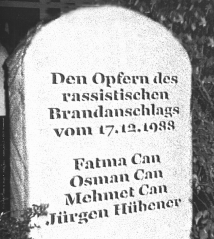 |
Gegen das Vergessen Bündnis gegen Rechts |
|
|
Jahreswechsel |
Zehn Jahre nach tödlichem Brandanschlag in SchwandorfStreit um Mahnmal für Neonazi-OpferPolitisch Verantwortliche im Rathaus lehnen Gedenkstein für türkische Familie abSchwandorf (dpa) - Blinder Ausländerhass kostete in der Nacht zum 17. Dezember 1988 in Schwandorf einer dreiköpfigen türkischen Familie und einem Deutschen das Leben. Zehn Jahre später will ein Schwandorfer Bündnis gegen Rechts einen Gedenkstein für die Opfer errichten. Aber die politisch Verantwortlichen in der 27 000 Einwohner zählenden Stadt haben sich gegen das Mahnmal ausgesprochen. Im Rathaus will man offenbar verhindern, daß Schwandorf mit anderen Orten rechtsextremer Verbrechen wie Solingen, Mölln und Rostock in einem Atemzug genannt wird. Es habe sich bei dem Anschlag um die Tat eines Einzelnen gehandelt, in Schwandorf gebe es keine rechte Szene, erläutert eine Sprecherin der Stadt die Haltung von Oberbürgermeister Hans Kraus: "Das ist der Unterschied zu Städten wie dem sächsischen Hoyerswerda." Die Behörde des CSU-Oberbürgermeisters lehnte in den vergangenen Jahren mehrfach Anträge auf Errichtung eines Gedenksteins ab. "Das tragische Ereignis wird den Bürgern auch ohne Mahnmal in Erinnerung bleiben", beschied die Stadtverwaltung zuletzt im Februar dieses Jahres. Vertreter von Kirchen, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und andere Gruppen hatten immer wieder angeregt, auf einen kleinen Grünstreifen am Ort des Verbrechens ein Mahnmal zu stellen. Einige Wochen, nachdem die Idee 1994 erstmals an die Stadt herangetragen wurde, ließ die Verwaltung die fragliche Fläche mit einer Telefonzelle zubauen. "Wir werden auf keinen Fall Steuergelder für einen Gedenkstein ausgeben", sagt der zweite Bürgermeister Michael Kaplitz. Der CSU-Politiker hält die Idee für "inhuman". Ein Denkmal für die Toten des Neonazi-Anschlags sei "eine Diskriminierung von anderen Mordopfern". Schließlich würden für Frauen, die von Sexualtätern verstümmelt worden seien, auch keine Mahnmale errichtet, sagt der hauptberuflich als Rechtsanwalt tätige Kommunalpolitiker. Für ihn ist die Tat des Mannes, der früher in der Stadt rassistische Schriften verbreitete, ein "Verbrechen wie jedes andere auch". Vor den Jugendrichtern, die den aus Schwandorf stammenden Neonazi 1990 zu einer Strafe von zwölfeinhalb Jahren Haft veruuteilten, ergab sich aus den Zeugenaussagen das Bild eines glühenden Verehrers von Adolf Hitler, der den "Führer-Geburtstag" regelmäßig feierte. Der zur Tatzeit 19jährige Mann, der im Münchner Olympiastadion während eines Bundesligaspiels nach "Sieg Heil" -Grölereien festgenommen worden war, habe in seiner Heimatstadt mit 20 Skinheads eine Wehrsportgruppe gründen wollen, sagten Bekannte des Neonazis beim Prozeß aus. Am 17. Dezember 1988 legte er im Treppenhaus eines überwiegend von Türken bewohnten Hauses in der Schwandorfer Innenstadt ein Feuer. Zwölf Mieter wurden teilweise schwer verletzt. Ein zwölfjähriger Bub, seine Mutter (44), der Vater (50) und ein 47 Jahre alter Deutscher verbrannten. Von dem Haus blieb nur eine Ruine zurück. Um an das traurige Kapitel der jüngeren Schwandorfer Stadtgeschichte zu erinnern, beschaffte ein Bündnis gegen Rechts kürzlich einen Granitstein, in den ein Steinmetz die Namen der Toten gravieren soll. Das Bündnis will den Stein bei einer Gedenkkundgebung am 19. Dezember enthüllen. Mit der privaten Initiative sollte sich der Stadtrat bereits im Oktober beschäftigen. Die Stadträtin und ehemalige Grünen-Landtagsabgeordnete Irene Maria Sturm hatte einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag eingebracht. Doch der Stadtrat vertagte den Antrag. Jetzt wird die Forderung nach einem Mahnmal voraussichtlich am 15. Dezember auf der Tagesordnung stehen - zwei Tage vor dem 10. Jahrestag des Anschlags. Ulf Vogler Süddeutsche Zeitung v. 08.12.1998 |